Keine Frage: In dem langen Drama der Spaltung der amerikanischen Politik und Gesellschaft, welches das Land in den Zustand eines kalten Bürgerkriegs geführt hat, war der Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen 2020 ein vorläufiger und zugleich trauriger Höhepunkt. In einem Klima gegenseitigen Misstrauens und der Hysterie verstanden die Anhänger beider Seiten die Wahl nicht alleine als politische Richtungsentscheidung, sondern als Schlacht um die Demokratie selbst. Bereits ein gutes Jahr vor der Wahl, im Herbst 2019, zirkulierte eine Umfrage, wonach beinahe ein Fünftel der Anhänger beider Parteien der Meinung war, dass Gewalt gerechtfertigt sei, wenn die andere Seite die Wahl gewönne. Dass sich all das entladen könnte, war die Befürchtung vieler; dass es so nicht gekommen ist, ist eine der wenigen guten Nachrichten. Ausgestanden aber ist natürlich nichts angesichts der Tatsache, dass eine Mehrheit der Wähler der Republikanischen Partei Ende November 2020 der Meinung war, die Wahl sei gefälscht und Joe Biden damit illegitim ins Amt gekommen.
Amerikas Demokratie wird auch diesen vorerst letzten Akt noch einmal aushalten. Aber wie lange das Land eine solchen Polarisierung noch tragen kann, das scheint eine berechtigte Frage zu sein – und sie ist gewiss naheliegender, als die viel häufiger gestellte, aber grenzenlos naive Frage, ob denn nun, nach dem Abgang Trumps und Joe Bidens Einzug ins Weiße Haus, eine »Versöhnung« folgen werde. Das überschätzt nicht nur den Einfluss von Personen, sondern verkennt auch, dass letztlich keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat.
Um zu erfahren, auf was das Land zusteuert, müsste man den Fokus schon zeitlich beträchtlich erweitern, da es, wenn überhaupt, nur langfristig eine Milderung der politischen Spannungen geben dürfte. Es gilt dann natürlich, sich frei zu machen von mehr oder weniger polarisierenden Präsidenten (dass da in Anspruch und Stil ein Unterschied zwischen Biden und Trump existiert, ist ja nicht ernstlich die Frage), den Folgen der Pandemie und anderem, was kurzfristig bestimmend sein könnte. Es geht stattdessen darum, zu verstehen, was die toxische Polarisierung des Landes überhaupt verursacht hat. Erst in einem zweiten Schritt wäre danach zu fragen, welche dieser strukturellen Probleme sich auflösen könnten – und welche wiederum eher noch an Schärfe zunehmen dürften. Grob lassen sich die Ursachen für Amerikas Hyper-Polarisierung in zwei Ebenen unterteilen: Erstens die konkreten Konfliktlinien und Interessenlagen, die das Land prägen; und zweitens eine eher wissenssoziologische Ebene, die erklärt, warum Amerika in disparate und nicht länger miteinander kompatible Realitätswelten zerfiel.
Die langfristigen Konfliktlinien der amerikanischen Gesellschaft
Beginnen wir also mit den Konfliktlinien im Land: Woher rühren sie? Und inwiefern ließen sie sich überwinden?
Da ist, erstens, und fraglos dominant, der Konflikt um Race, also der Streit um die ethnischen Ungleichheiten im Land. Der Ursprung liegt in den 60er Jahren, als die Demokraten sich mit der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King alliierten und endlich entschiedener den Rassismus vor allem im Süden des Landes bekämpften. Die Maßnahmen stießen auf Widerstand vor allem im konservativen Süden der USA, deren Wähler kollektiv zur Republikanischen Partei überliefen. Seitdem wird nicht nur darüber gestritten, wie stark der Staat eingreifen sollte, um Ungerechtigkeiten zu überwinden. Strittig ist überdies, inwiefern ein »systemischer Rassismus« die US-Gesellschaft dominiert. Während bei den Demokraten dies als Binsenweisheit gilt, halten die Republikaner das Reden darüber für eine perfide Strategie der US-Linken, alle konservativen Positionen von vornherein zu diskreditieren.
Die zweite Konfliktlinie: Religion. Wie auch auf der anderen Seite des Atlantiks erleben die USA seit den 60er Jahren einen tiefgreifenden Liberalisierungsschub, durch den traditionelle Wert- und Normvorstellungen herausgefordert wurden. Doch anders als im sich rasch säkularisierenden Europa blieb ein Teil des Landes tief religiös und verteidigte äußerst aggressiv eine christliche Sozialmoral. Seit den 70er Jahren stritt das Land in den »Culture Wars« über Abtreibung, Pornografie und Homosexualität. Wer sich fragt, warum so viele religiöse Amerikaner Trump bis heute die Treue halten, der findet hier die Antwort: weil es ihnen buchstäblich um ein letztes Gefecht zu gehen scheint, bei dem auch fragwürdige Verbündete zu akzeptieren sind – und weil Trump für sie, u. a. mit der Ernennung dreier konservativer Richter für den Supreme Court, voll abgeliefert hat.
Der dritte und letzte prägende Großkonflikt – und am ehesten übertragbar auch auf die europäischen Verhältnisse – ist jener zwischen den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung, der vor allem auch ein Konflikt ist zwischen prosperierenden Metropolen und immer weiter zurückfallenden ländlichen Regionen. Dieser Konflikt liegt quer zu allen Klassenlinien. Während ärmere und sozial deklassierte Amerikaner in den Metropolen oft demokratisch wählen, hat sich Amerikas weiße Arbeiterklasse aggressiv von den Demokraten abgewandt und wählt seit langem republikanisch.
Entscheidend ist: All diese Konfliktlinien korrespondieren mittlerweile miteinander, haben dadurch alle ideologischen Schnittflächen und auch Ambivalenzen ausgelöscht, Amerika buchstäblich zweigeteilt. So steht heute ein weißes, christliches, ländliches Amerika gegen ein multiethnisches, religiöses, urbanes Amerika. Es handelt sich also um das, was Politikwissenschaftler als »reinforcing cleavages« bezeichnen, was weitaus gefährlicher ist, als eine Gesellschaft mit multiplen Konflikten, die aber nicht zur Bildung zweier antagonistischer Lager führen.
Und doch: So unversöhnlich diese Konfliktlinien auch verlaufen: Zumindest bei den ersten beiden ließe sich auch plausibel argumentieren, dass es sich um Modernisierungskrisen handelt, die in Phasen des Übergangs – wenn eine Seite fürchtet, ihren bisherigen Status zu verlieren – gehäuft auftreten. Was wir etwa gerade beim Thema Race erleben, das ist offenkundig einer solchen Umbruchsituation geschuldet: der Kampf einer bald nur noch ehemaligen Mehrheitsgesellschaft, die ihren privilegierten Status aggressiv verteidigt. Und die tatsächlichen Animositäten zwischen den Hautfarben haben in Wahrheit abgenommen, offener Rassismus wird – Trump zum Trotz – heute seltener artikuliert als noch vor Jahrzehnten. Was in den USA gerade verhandelt wird, das ist tatsächlich das Ende der Dominanz des weißen Amerikas. Wer wollte erwarten, dass solcherlei ganz ohne Friktionen abliefe?
Auch beim Thema Religion scheinen viele der Fronten bei einem Blick in die Meinungsumfragen und Statistiken viel weniger tief als es die polarisierten Auseinandersetzungen, etwa um die Ernennungen der Richter des Supreme Courts glauben machen könnte. Mit Ausnahme des Themas Abtreibung sind die USA insgesamt über Jahrzehnte liberaler und toleranter geworden. Ein Thema wie Homosexualität etwa wird von der Republikanischen Partei bei Wahlkämpfen kaum noch angerührt. Die Anzahl der streng religiösen Protestanten geht zurück, wenngleich die Entkirchlichung des Landes weit langsamer voranschreitet als in Europa. So könnte sich auch der Kulturkrieg irgendwann abschwächen.
Einzig beim dritten Konflikt – zwischen den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung und dem Gegensatz zwischen Stadt und Land – scheint viel weniger klar, wie er sich in Zukunft entwickeln wird. Die Deindustrialisierung des Landes wurde durch Trumps »America First«-Kurs jedenfalls kaum aufgehalten, und auch die Demokraten haben seit langem kein Konzept, wie die abgehängten Regionen des Landes wieder Anschluss finden könnten. Doch diese Konfliktlinie allein dürfte kaum in jener existenziellen Konfrontation münden, die in der Trump-Präsidentschaft kulminierte und die vorwiegend kulturell geprägt ist.
Paradoxe Individualisierung
Allerdings gibt es eine zweite Erklärungsebene für Amerikas tiefe Spaltung; und diese lässt nicht viel Hoffnung aufkeimen. Sie beschreibt eher einen übergeordneten soziologischen Prozess, den man von konkreten Streitfragen im Grunde trennen muss. Amerika zerfällt nämlich auch deswegen, weil es besonders früh und stark den Zentrifugalkräften einer entfesselten Moderne ausgesetzt ist. Es ist ein Prozess, den ich als »paradoxe Individualisierung« bezeichne: Nie zuvor in der Geschichte hatten so viele Menschen so viele Freiheiten, wie sie ihr Leben führen möchten: wo sie leben, welchen Vorlieben sie nachgehen wollen, wen sie lieben und, vor allem, welche Arten von Informationen sie konsumieren möchten. Doch hat sie all die Wahlfreiheit nicht in ambivalente postmoderne Flaneure verwandelt, sie nicht offener und toleranter für andere Lebensentwürfe gemacht. Stattdessen wurde all die Autonomie dazu genutzt, eine widerspruchsfreie Welt zu bauen: Echokammern von Gleichgesinnten (keineswegs nur, aber gewiss vor allem auch in den sozialen Netzwerken), die sich durch das Ausbleiben von Dissens radikalisiert haben. Demokraten und Republikaner leben nicht länger nebeneinander, heiraten kaum noch untereinander, beten nicht länger in den gleichen Kirchen – und schon gar nicht lesen sie die gleichen Zeitungen oder schauen die gleichen Nachrichtensendungen. Das hat ihre Lebenswelten weit voneinander entfernt, lässt sie die Welt aus diametral anderen Perspektiven betrachten. Und oft sind es – und zwar auf beiden Seiten der Barrikade – gerade die höher gebildeten und sozial besser gestellten US-Bürger, die besonders homogene Netzwerke pflegen.
Wie aber sollte sich das abschwächen? Es handelt sich um einen sozialen Prozess von solcher Grundsätzlichkeit und Tiefe, dass nicht erkennbar ist, wie er durchbrochen werden könnte. Um zum Anfang unserer Überlegungen zurückzukehren: In welcher Weise sollte auch der gut gemeinteste Appell in Richtung Versöhnung an diesen grundlegenden Strukturen etwas ändern? Möglich, dass sich der politische Diskurs des Landes beruhigt, wenn nicht länger der »twitterer-in-chief« im Weißen Haus sitzt. Und auch nach Habitus und Herkommen dürfte Biden vielleicht nicht ganz die gleichen Ressentiments wie Barack Obama oder auch Hillary Clinton wecken. Allein: Den harten Kern der Republikaner wird nichts davon überzeugen. Diese Menschen werden Biden nach vier Jahren, in denen Trump unablässig das Vertrauen in die Institutionen, den Wahlvorgang und die gesamte politische Klasse weiter untergraben hat, den neuen Präsidenten immer noch für einen unrechtmäßigen Usurpator halten – übrigens ebenso, wie die meisten Demokraten es mit Trump gehalten haben.
Polarisierung und Demokratie
Sehr rosig sieht es also nicht aus. Dabei ist wichtig zu betonen, dass Polarisierung an sich nicht unbedingt ein Problem sein muss. Demokratien, gerade wenn sie auf eine lange eingeübte Tradition zurückblicken können, erweisen sich oft als erstaunlich robust und halten glücklicherweise eine ganze Menge an Streit aus. Daher gilt: Die fast schon reflexhafte Besorgnis, die sich in Formeln wie jener von der »tiefen gesellschaftlichen Spaltung« und ähnlichem ausdrückt, ist zunächst einmal kritisch zu hinterfragen. Denn liberale, repräsentative Demokratien sind schließlich dafür da, dass in ihnen gestritten wird, manchmal eben auch erbittert. Im Grunde verdankt die Demokratie ihr Überleben und ihre Überlegenheit gegenüber anderen Regime-Typen der Tatsache, dass sie einerseits Konflikte nicht um den Willen einer fiktiven gesellschaftlichen Harmonie unterdrückt – doch dann gleichzeitig auch Regeln aufstellt, mit der sie nicht aus dem Ruder laufen, sondern friedlich geregelt werden können.
Das Problem ist nur: Polarisierung ist eben nicht gleich Polarisierung. Es gibt grob gesagt drei Merkmale, an denen wir erkennen können, dass sie ein ungesundes Maß erreicht hat – und alle drei dürften für die USA vorliegen.
Da ist zum einem die Frage, welche Art von inhaltlichen Konflikten dominieren. In der Konfliktsoziologie wird zwischen teilbaren und unteilbaren Konflikten unterschieden. Die ersten haben einen Streit zum Gegenstand, bei dem ein bestimmtes öffentliches Gut und dessen Verteilung im Mittelpunkt stehen. Man kann sich dann irgendwo in der Mitte treffen, und es gilt die alte Binsenweisheit, dass bei einem gelungenen Kompromiss am Ende alle Beteiligten unzufrieden sind. Teilbare Konflikte sind z. B. sozioökonomische Verteilungskonflikte. Nun sollte man die Härte der Auseinandersetzungen auch hier gewiss nicht unterschätzen. Aber sie sind doch noch immer leichter zu lösen als jene unteilbaren Konflikte, die die USA derzeit beschäftigen: Kämpfe um Anerkennung und Identität, die um so schwer greifbare Dinge wie moralischer Niedergang oder moralische Erneuerung kreisen. Und gerade weil oft nicht ganz klar ist, welche konkreten politischen Differenzen es gibt, ist auch die Möglichkeit eines Kompromisses oft so unmöglich. Wer glaubt, um ausnahmsweise einmal mit den in Teilen durchaus radikalisierten Positionen des linken Amerika zu argumentieren, dass die Geschichte der USA einzig die Geschichte von Rassismus, Gewalt und Unterdrückung ist und all dies bis in die Gegenwart ungebremst fortgeführt wird, für den kann jede Reform doch nur ungenügend sein.
Beim zweiten Merkmal, das uns etwas darüber verrät, wie ernst die Lage ist, ist die Dynamik bereits einen Schritt weiter. Jetzt sind es nicht mehr allein unüberbrückbare politische Inhalte, über die gestritten wird – stattdessen rückt jetzt der politische Prozess selbst in den Mittelpunkt: wenn es etwa darum geht, wer rechtmäßig im Amt ist, und ob es bei den letzten Wahlen mit rechten Dingen zugegangen ist; welche Rechte Regierung und Opposition besitzen; wenn die Autorität anderer Verfassungsorgane angezweifelt wird (z. B. wenn die Exekutive die Gültigkeit der Urteile unabhängiger Richter infrage stellt). Dann geht es um politische Legitimität – und ein solcher Streit hat das Potenzial, irgendwann in einen Verfassungskonflikt zu münden. Von diesem Punkt an werden schließlich jene fundamentalen Machtfragen gestellt, die in einer Demokratie eigentlich nicht auf der Agenda stehen sollten.
Das alles klingt zunächst wie eine Beschreibung der USA in der Ära Trump. In diesem Sinne steckt das Land fraglos mitten in einer Legitimitäts- und Verfassungskrise. Bedenkt man die Heftigkeit der Angriffe, den überaus erfolgreichen Versuch Trumps und großer Teile der Republikanischen Partei, das Vertrauen in die Institutionen und den politischen Prozess zu untergraben – alles gipfelnd in der Nicht-Anerkennung einer Wahlniederlage – dann stellt sich allerdings eher die Frage, warum das System bisher so gut gehalten hat. Das liegt primär an einer starken, unabhängigen Justiz, einem wachsamen Mediensystem und einer lebendigen Zivilgesellschaft. Es liegt überdies daran, dass Trump zwar die Ambitionen eines waschechten Autokraten besitzt, aber nicht über die dafür notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt. Vor allem hat er, das ist das große Glück der letzten vier Jahre, versäumt, was ein faschistischer Parteiführer natürlich vom ersten Tag an in die Wege geleitet hätte: den Staatsapparat mit den eigenen Gefolgsleuten zu besetzen, um für die große Machtprobe vorbereitet zu sein. Ein solches Netzwerk aber besitzt Trump nicht; abgesehen davon, dass ihm, in dem Irrglauben, fortan als gewählter aber absoluter Monarch zu regieren, die Wichtigkeit effizienter Patronage nie bewusst gewesen sein dürfte. So erwiesen sich alle Horrorfantasien, Trump könnte am Ende durch einen Staatsstreich an der Macht bleiben, als mehr als nur ein bisschen verwegen.
Das alles aber lenkt noch einmal den Blick auf die Rolle der Republikanischen Partei. Es ist zwar keine Frage, dass es sich bei ihr um einen besonders rückgratlosen Haufen skrupelloser Machtpolitiker handelt, die Trump noch alles haben durchgehen lassen. Und doch: Wenn es bisher gut gegangen ist, dann liegt das auch an einer historisch einzigartigen Paradoxie: dass die Feinde der Demokratie keine dezidierten Anti-Demokraten sind. Das mag merkwürdig klingen angesichts all der Tabu- und Normbrüche seit 2016. Aber das ideologische Herz der Partei besitzt keine genuin anti-demokratische Haltung. Da ist keine Gegenideologie, die von einer ganz anderen Staatsform träumt. Ja, selbst eine pervertierte Form wie Victor Orbáns »illiberale Demokratie« spielt in den Vorstellungswelten konservativer Amerikaner keine Rolle. Führen wir das Paradox noch einen Schritt weiter: Ironischerweise ist es dieses Bekenntnis zur Demokratie, die den US-Konservatismus zur Heimstatt einer Vielzahl fürwahr abgedrehter Verschwörungstheorien hat werden lassen. Überzeugt davon, dass Demokratie ohne Alternative ist und nie daran zweifelnd, wie alle Populisten, eine schweigende Mehrheit zu vertreten, kann kein Wahlergebnis akzeptiert werden, das dem Anspruch, die einzige wahre Stimme des Volkes zu sein, widerspricht. Nach dieser Logik muss dann etwas faul sein im Staate. So wurde die Paranoia zum zentralen Motiv der Partei und vor allem ihres medialen Vorfeldes.
Das sollte nun kein Anlass zur Entwarnung sein, denn diese Geisteshaltung hat gewiss längst katastrophale Folgen gezeitigt. Und schließlich: Vielleicht wächst als Reaktion auf die Niederlage doch irgendwann eine harte Alternative zur bestehenden Ordnung heran. Vielleicht war Trump nicht das Ende, sondern eher der Anfang: Vielleicht kommt nach ihm jemand mit den gleichen populistischen Instinkten, aber nicht nur mit mehr strategischem Gespür – sondern auch mit einer wirklichen Überzeugung, das System auszuhebeln. Solange das aber nicht der Fall ist, wird Amerika bleiben, was es ist: tief zerstritten, gesellschaftlich vergiftet, politisch blockiert – aber doch auch weiterhin eine funktionierende Demokratie.

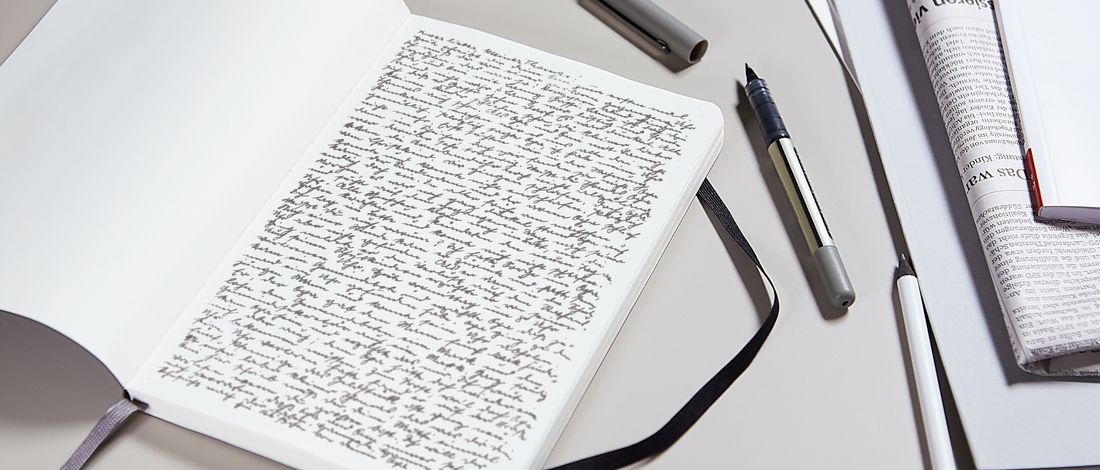


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!