Schwarz oder weiß, Yin oder Yang, Tag oder Nacht – die Sprache ist reich an Gegensätzen. Und die Welt? Das eine ist vom anderen hier oftmals nicht klar geschieden, das scheinbar Unvereinbare vermischt sich zum Hybrid. Männlich, weiblich, oder queer dazu? Altmodisch, zeitgemäß oder im gerade angesagten Retrostil? Einheimisch, fremdländisch oder kosmopolitisch? Zwischen dem Einen und dem Anderen gibt es den weiten Bereich des Dazwischen und des Sowohl-als-auch. Anstelle von stabilen Einheiten und Identitäten mit klaren Konturen scheint die Welt aus veränderlichen Kombinationen von Merkmalen zu bestehen, die miteinander in Konflikt geraten können, sich widersprechen oder auch ausgleichen.
Wo lebt man? In der Stadt oder auf dem Land? Die Grenzen haben sich verwischt. Was früher bevorzugt mit dem Land in Verbindung gebracht wurde, wird mittlerweile als Trend in den Städten ausgerufen, mit modischen englischen Bezeichnungen wie urban wandering, urban gardening, urban birding. Wenn der Wanderer es nun dem Flaneur gleichtut und durch eine städtische Umgebung streift, mag er an dieser vielleicht gerade die Spuren menschlichen Wirkens schätzen, die hier geballter auftreten als bei einem Gang durch die Landschaft. Wer in der Stadt gärtnert, reiht sich in eine lange Tradition ein, die Pflanzenwelt in den urbanen Raum zu integrieren, wie in den manchmal parkähnlichen Anlagen um die Stadtvilla, den Selbstversorgergärten hinter dem Reihenhäuschen, den Schrebergartensiedlungen abseits der Bebauung. Wo hört hier Stadt auf, fängt Natur an? Für den urban birder (also den städtischen Vogelbeobachter) David Lindo sind Stadt und Natur keine Gegensätze – die Natur in der Stadt zu entdecken, ist eine Frage der Perspektive. Er schreibt auf seiner Website theurbanbirder: »I believe wildlife in urban areas is so easy to engage with. All we have to do is open our eyes, ears, hearts and minds and soon we will be linked into the nature around us.«
Und der Lebensstil auf dem Land ist längt urbanisiert. Für Viele ist der Wohnort ohnehin nicht der Arbeitsort, sie pendeln aus dem Umland in die Städte. Andere nehmen den Weg auf sich, um Besorgungen zu machen oder kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Über das Internet und Fernsehen ist man aber auch dann mit der Welt außerhalb der Ortschaft verbunden, wenn man zu Hause bleibt. Die großstädtische Einkaufsmeile, das Warenhaus, das Filmtheater finden sich in digitalisierter Form im eigenen Wohnzimmer. Das ländliche Leben ist heute durchdrungen von Angeboten und Verhaltensmustern, die man einst nur in den Städten finden konnte.
Die Welt sickert in die Orte ein
Es wurde in letzter Zeit viel über Heimat diskutiert. Aber ist der Raum, dem man sich mehr verbunden fühlt als anderen, weil man in ihm auch mehr Zeit verbracht hat als andernorts, denn überhaupt so besonders? Natürlich gleicht kein Fleck Erde dem anderen. Doch vielerorts zeigen sich ähnliche Tendenzen. Das Bauen orientiert sich an internationalen Standards. Die Wirtschaft ist global verflochten, was sich auch in den Filialen und im Warenangebot in der lokalen Fußgängerzone widerspiegelt. Tourismus und Migration gehen damit einher, dass man auf den Straßen verschiedene Sprachen hört. Was seinen Ursprung in der Ferne haben mag, gehört vor Ort längst dazu. Man bewegt sich also durch eine Zusammenstellung von Menschen, Gebäuden, Gegenständen, die mal alteingesessen, mal gerade erst hier angekommen sind und deren Stile lokale Traditionen aus ganz unterschiedlichen Gegenden zum Ausdruck bringen können, wenn diese überhaupt noch verortet sind. Und die Aufmerksamkeit richtet sich nicht nur auf das, was einen unmittelbar physisch umgibt – in den Nachrichten und im Internet sind Inhalte von anderswo der Regelfall.
Genauso wie seine Umwelt erlebt man sich selbst als uneindeutig, vielerlei Einflüssen unterliegend und immer wieder neue Gewohnheiten annehmend. Was macht das Eigene aus, wo fängt das Fremde an? Das ändert sich im Lauf der Zeit – wenn man durch neue Interessen oder Kontakte zu einem anderen Denken und Verhalten angeregt wird, wenn man frische Eindrücke bekommt z. B. auf Reisen, wenn man mit der Zeit geht und sich der Geschmack wandelt. Das Verhaltensrepertoire wird auch den Gegebenheiten angepasst, im Beruf verhält man sich nicht wie in der Familie, im Sportverein nicht wie im Lesekreis, in der Oper nicht wie im Club. Man findet sich im Zwiespalt wieder oder empfindet gemischte Gefühle. Manchmal sagt man nicht, was man denkt, oder handelt nicht im Einklang mit seinen Überzeugungen. Auch die persönliche Identität erscheint als Stückwerk. Besonders augenfällig wird das bei Menschen, die aufgrund einer Migrationsbiografie in verschiedenen Kulturen zu Hause sind, zwischen Sprachen wechseln, sich in weitläufigen Netzwerken bewegen. Doch auch die Sesshaften agieren in der Regel in verschiedenen Kontexten und identifizieren sich mit heterogenen Gruppen.
Dass Mensch und Welt nicht eindeutig sind, mag als Mangel an Klarheit erscheinen. Der Soziologe Zygmunt Bauman hat Ende des letzten Jahrhunderts die Moderne rückblickend als Zeit mit einem stark ausgeprägten Ordnungsdrang bis hin zum Ordnungswahn beschrieben. Chaos, Kontingenz und Unbegreiflichkeit machen Angst. Dem wird ein Denken entgegengesetzt, in dem die Welt als gegliedert in Klassen klar abgrenzbarer Einheiten vorgestellt wird, zwischen denen nicht zufällige Wirkungszusammenhänge bestehen, die sich isoliert erkennen und in Technologien anwenden lassen. Es wird sortiert, systematisiert, vermessen, einzelne Beziehungen werden aus der Totalität herausgelöst und in Modellen abgebildet. Dadurch wirkt die Welt durch den Menschen beherrschbar.
Nun steht ein Denkgebäude, das der Komplexität der Gegebenheiten und Effekte gerecht würde, allerdings weiterhin aus. Es gibt die unbeabsichtigten Nebenwirkungen und es bleibt schwierig, sich ein Bild von Bedingungen zu machen, bei denen viele Faktoren eine Rolle spielen. Das Chaos lässt sich nicht bändigen. Versuche, zumindest auf sozialer Ebene Ordnung zu schaffen und all diejenigen zu eliminieren, die nicht bestimmten normativ gesetzten Kriterien entsprechen, schockieren aufgrund ihrer Inhumanität. Der Moderne, so Bauman, wohne ein zerstörerisches genozidales Potenzial inne – das sich nur durch Pluralismus und damit durch Mehrdeutigkeit eindämmen und entschärfen lässt. »Mich persönlich beruhigt kulturelle oder religiöse oder sexuelle Verschiedenheit in einem säkularen Rechtsstaat. Solange ich diese Verschiedenheit im öffentlichen Raum sehe, so lange weiß ich auch die Freiheitsräume gewahrt, in denen ich als Individuum mit all meinen Eigenheiten, meinen Sehnsüchten, meinen möglicherweise abweichenden Überzeugungen oder Praktiken geschützt werde«, schreibt Carolin Emcke in ihrem Buch Gegen den Hass.
Pluralität zu akzeptieren ist ein gemeinsamer Nenner postmodernen Denkens. Eingeschlossen ist die Vielfalt der Sichtweisen auf die Welt, die Standortgebundenheit des Wissens, der Abschied von der Idee der absoluten Wahrheit, da Positionen, Fragen und Antworten nur innerhalb eines Diskurses, eines Paradigmas einen Sinn ergeben. Ist in den großen Erzählungen der modernen Weltdeutung eine Perspektive allen anderen übergeordnet, zerfällt nun die Suche nach Wahrheit in eine Vielzahl von Stimmen, denen jeweils eine gewisse Berechtigung zukommt. Die Gefahr, dass eine Denk- und Lebensweise als allgemeinverbindlich erklärt und notfalls mit Gewalt durchgesetzt wird, nimmt ab, stattdessen stellen sich Probleme der Beliebigkeit und Verständigung. Die Akzeptanz von Differenz führt nicht automatisch zur Hinwendung zum Fremden. Sie kann genauso gut mit Indifferenz einhergehen, dem Rückzug auf das Eigene und der Verweigerung der Anerkennung des Anderen – was oft als Leben in einer bestimmten Blase beschrieben wird, in der das Ich und die Welt in einem stimmigen Verhältnis stehen, weil alles, was die Harmonie stören könnte, außen vor bleibt.
In der Multioptionsgesellschaft wird auch leicht übersehen, dass nicht jede Lebensform Ausdruck einer freien Wahl ist. Wenn das Nebeneinander von Reichtum und Armut nur als eine weitere Facette der Vielgestaltigkeit der Welt aufgefasst wird, verdrängt das Bekenntnis zur Vielfalt die Vision sozialer Gerechtigkeit als einer fairen Verteilung von materiellen und immateriellen Ressourcen. Bauman kommentiert in Moderne und Ambivalenz: »Wieder einmal kann man, wie in der vormodernen Zeit, überzeugt von der unergründlichen und zeitlosen Weisheit der göttlichen Ordnung, mit dem täglichen Anblick von Hunger, Heimatlosigkeit, Leben ohne Zukunft und Würde leben; glücklich leben, den Tag genießen und in der Nacht gut schlafen.« Ohne Empathie für diejenigen, die in der Sozial- und Wirtschaftsordnung benachteiligt werden, sind deren Licht- und Schattenseiten für den Begünstigten nicht erkennbar (und umgekehrt).
Thomas Bauer warnt in einem gleichlautenden 2018 erschienenen Essay vor einer »Vereindeutigung der Welt«. Grund seiner Sorge ist eine abnehmende Ambiguitätstoleranz, also die nachlassende Fähigkeit, mehrdeutige Situationen auszuhalten und sich auf die Komplexität der Wirklichkeit einzulassen. Anstatt Vielfalt und Mehrdeutigkeit als Bereicherung anzunehmen, werden fundamentalistische Wahrheiten hochgehalten oder widersprüchliche Zusammenhänge durch Gleichgültigkeit dem Bewusstsein entzogen. Verschiedenartigkeit ist nur noch erträglich, wenn ihre Träger fixen Kategorien zugeordnet werden – die Gleichzeitigkeit des Ungleichen erscheint so weniger beunruhigend.
Das ist nicht nur dann problematisch, wenn das Festnageln auf die Zugehörigkeit zu einem Typus damit einhergeht, dass die einen (wir) gegenüber den anderen (sie) als hochwertiger und mit mehr Rechten ausgestattet gedacht werden. So wichtig gleiche Rechte für Mehr- und Minderheiten sind, so berechtigt erscheinen auch die Bedenken, dass eine auf Besonderheiten fokussierte Identitätspolitik den Blick auf das Gemeinsame und Verbindende in einer vielgestaltigen Gesellschaft verstellt. Bauman argumentiert, dass es mit Toleranz nicht getan ist – erst Solidarität überbrückt Differenzen, sodass Verständigung und gemeinsames Handeln möglich werden. Für Bauer setzt Demokratie voraus, sich auf die Vieldeutigkeit der Welt einzulassen. Zur Gespaltenheit, die heute in vielen Ländern diagnostiziert wird, schreibt er: »Eine solche Gespaltenheit lässt sich aber weder durch Authentizitätsverherrlichung, Identitätshuberei noch durch fundamentalistisches Wahrheitsbeharren überwinden. Ohne Akzeptanz einer notwendigen, wenn auch lästigen, Diskrepanz zwischen den eigenen Wünschen, Idealen und Überzeugungen einerseits und den Erfordernissen der Um- und Mitwelt andererseits, also kurz: ohne Ambiguitätstoleranz, wird sich diese Gespaltenheit nicht überwinden lassen, sondern sich immer weiter vertiefen.«
Ambivalenz mag Unsicherheit erzeugen, doch Eindeutigkeit ist Reduktion und Mangel: Vereinseitigung, Beschränkung, Absonderung, Ignoranz gegenüber den Möglichkeiten, die sich nicht ins Raster fügen. Wird das Denken für Vielschichtigkeit geöffnet, ergeben sich neue Optionen des Handelns und Grenzen werden eingerissen. In der persischen Legende, die der kanadische Schriftsteller Wajdi Mouawad in seinem Theaterstück Vögel nacherzählt, klingt die Utopie der Aufhebung vermeintlicher Unvereinbarkeit so: »An einem See übt sich ein Jungvogel zum ersten Mal im Fliegen. Als er die Fische unter der Wasseroberfläche sieht, erfüllt ihn große Neugier für diese wunderbaren Tiere, die so anders sind als er. Er fliegt im Sturzflug zu ihnen herunter, aber der Vogelschwarm, seine Großfamilie, fängt ihn sogleich ab und warnt ihn: ›Geh nie zu diesen Wesen. Sie sind nicht von unserer Welt und wir nicht von ihrer. Wenn du in ihre Welt gehst, wirst du sterben, so wie sie sterben würden, kämen sie zu uns. Unsere Welt würde sie töten und ihre Welt würde uns töten. Wir sind nicht geschaffen, uns zu begegnen.‹ Die Jahre vergehen und tiefe Schwermut überwältigt ihn, wenn er die Fische beobachtet, die für ihn unerreichbar sind. Als er eines wunderschönen Tages am See ist, um sie zu bewundern, erfasst ihn ein Rausch: ›Ich kann mein Leben nicht ohne das, was mich mit Leidenschaft erfüllt, vergehen lassen. Lieber sterben, als das Leben zu führen, dass ich führe.‹ Und er taucht hinab. Aber seine Liebe für das, was anders ist, ist so groß, dass ihm noch im selben Augenblick, als er die Wasseroberfläche durchbricht, Kiemen wachsen und ihm das Atmen ermöglichen. Inmitten der Fische sagt er zu ihnen: ›Ich bin’s, ich bin einer von euch, ich bin der Amphibienvogel.‹«

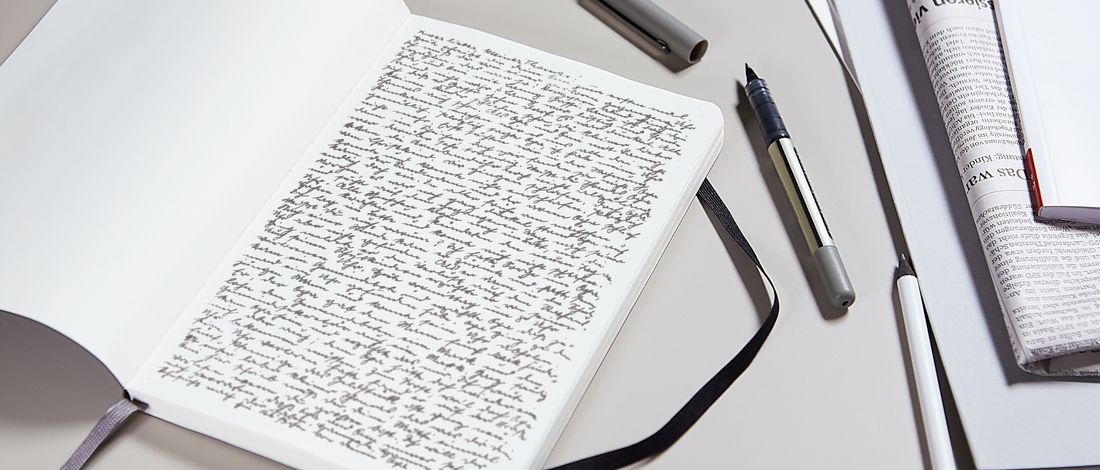


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!