Ist links noch das, was man kannte? Und rechts? Was ist das eigentlich heute? Wo sind die Konfliktlinien und wo die Unterschiede? Langsam dämmert es auch dem letzten politischen Beobachter, dass es »links« und »rechts« so eindeutig nicht mehr gibt.
Björn Höcke, der »Ultrarechte« dieser »rechten« AfD sagte in einem Interview mit der Welt: »Die neoliberale Ideologie, die von allen Altparteien getragen wird und Staaten zu Wurmfortsätzen global agierender Konzerne gemacht hat, entzieht den Volkswirtschaften dringend benötigtes Investitionskapital und senkt in den westlichen Industrienationen die Löhne zugunsten der Kapitalrendite.« Die AfD, zumindest der Flügel um Höcke, drängt gerade in das, was man in der Politikwissenschaft das »links-kommunitaristische« Milieu nennt. Dieses Milieu besteht nicht nur aus dem Gewerkschaftsmilieu. Sozialer Zusammenhalt ist diesem Milieu wichtig. Ökonomisch oder sozialpolitisch ist man also eher links – auch wenn man selbst eigentlich genug verdient.
Links-Kommunitaristen ist Sicherheit in allen Facetten sehr wichtig. Mit einer übertriebenen Individualisierung kann man hier nichts anfangen. Man versucht, sein Leben eigenständig zu leben, sieht den Staat aber sehr wohl in der Verantwortung einem das Leben zu verbessern. Moraldiskurse oder »#MeToo«-Debatten führt man hier eher selten – selbst wenn man davon profitiert. Zur Arbeit gehen, um das Haus, die Wohnung, das Auto, die Ausbildung der Kinder zu finanzieren; ein sicherer Job und eine planbare Zukunft – das sind die Dreh- und Angelpunkte der Links-Kommunitaristen. Freiheit ohne Sicherheit ist für sie nicht denkbar, Flexibilisierung und befristete Verträge sind keine »Chance«, sondern eine Belastung. Man will lieber wissen, was man morgen zu erwarten hat, eine ordentliche Bezahlung für gute Arbeit will man auch.
Diese Links-Kommunitaristen haben sich zuletzt oft nicht mehr wirklich verstanden gefühlt. Sie mögen nicht die Mehrheit der Bevölkerung sein, es sind aber Millionen von Wählern. Sie hatten zuletzt keinen richtigen Platz im politischen Raum, zumindest in Deutschland. In eine ähnliche Richtung geht die Analyse des Politikwissenschaftlers Wolfgang Merkel, der von einer neuen Konfliktlinie zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus spricht. Hier gibt es also eine Repräsentationslücke.
In anderen Ländern Europas – Frankreich, Österreich, Dänemark – sieht es anders aus. Dort haben zuletzt rechtspopulistische Parteien diese Lücke im politischen Raum gefüllt. Zunächst starteten die rechtspopulistischen Parteien weitgehend als neoliberale Parteien. So auch die AfD. Im europäischen Ausland konnte man aber in den letzten Jahren beobachten, dass diese Parteien eine sozial-nationale Wende vollzogen und sich zugleich von dem neuen Liberalismus der Hauptstädte abgrenzten. Paradebeispiel ist der Front National. Auch der war einmal eine neoliberale Partei. Zur Präsidentenwahl 2017 war er aber bereits die neue Arbeiterpartei in Frankreich. Die Neue Zürcher Zeitung bezeichnete den Front National 2015 entsprechend als »linksextrem, antikapitalistisch und marktfeindlich« – und eben nicht als »rechtsextrem«.
Ob die AfD es schafft, die Repräsentationslücke im links-kommunitaristischen Milieu zu schließen, ist ungewiss. Jedenfalls sollten die zarten Versuche der Höcke-AfD, den Testballon für eine »Linkswende« steigen zu lassen, sehr deutlich darauf hinweisen, dass zuletzt niemand wirklich im links-kommunitaristischen Quadranten einheitlich sichtbar war. Denn die AfD war ja nur kulturell in einer gewissen Weise kommunitaristisch, ökonomisch aber neoliberal. Und die SPD eben weltanschaulich auf einen liberalen Kosmopolitismus fokussiert und ökonomisch eben seit der Agenda 2010 auch an einem gewissen Neoliberalismus light orientiert. Ein neues prekäres Arbeitermilieu des neu entstandenen Niedriglohnsektors, wozu auch die Dienstleistungsarbeiter gehören, aber auch eben der Daimler-Facharbeiter und die Ingenieurin wurden somit zuletzt kaum bis gar nicht politisch repräsentiert. Sie wurden von einer tonangebenden kosmopolitischen Klasse ökonomisch und moralisch nach unten gedrückt. Das hatte Folgen bei Wahlen.
Die AfD hat laut einer Analyse von Infratest Dimap bei der Bundestagswahl mit großem Abstand am meisten bei den Arbeitern gepunktet (21 %) und bei den Arbeitslosen (auch 21 %). Bei der Bundestagswahl wählten 15 % aller Gewerkschaftsmitglieder die AfD. Hinsichtlich der Wahlentscheidung ist die AfD zu einer Partei der »kleinen Leute« geworden. Inhaltlich ist sie es noch nicht. Da steckt noch viel großbürgerlicher Konservatismus und viel Neoliberalismus drin. Die sogenannte »Alternative Mitte«, eine Vereinigung der Wirtschaftsliberalen und Pragmatikern in der AfD, kämpft hier gegen den Höcke-Flügel. An ihrer Seite stehen die Rechtskonservativen, die im Sinne einer CDU-Politik der 80er Jahre denken. Die »Alternative Mitte« möchte gerne in Harmonie mit der CSU und CDU regieren. Höcke will das nicht. Dieser Grundsatzkonflikt wird die AfD auch in naher Zukunft prägen. Ausgang ungewiss. Mit der Tendenz, dass die »Alternative Mitte« und Alice Weidel mit ihrem Turbo-Neoliberalismus gewinnen.
Höckes sozial-nationaler Kurs würde nämlich bedeuten, dass sich die AfD der SPD und der Linkspartei öffnen und um sie werben muss, um regierungsfähig zu werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Vor allem würden es SPD und DIE LINKE kategorisch ablehnen. Zu Recht. Die AfD wird entweder an der Seite der CDU regieren oder niemals. Eine »Koalition des Wohlstandschauvinismus« aus Christian Lindner, Alice Weidel und Jens Spahn kann man sich vorstellen. Eine Regierung aus Union und AfD, bei der die AfD die »soziale Heimatpartei« spielt, eher weniger. Auch wenn ein deutscher Front National sehr viel problematischer für die Linke wäre.
Die linke Mitte jedenfalls war zuletzt eben sehr schwach im links-kommunitaristischen Milieu. Das muss sie erkennen. Außer der Linkspartei gab es dort keinen, der ansatzweise für diese Menschen Politik machen wollte – weder vom Stil noch vom Inhalt. Aber bei der Linkspartei ist eben auch eigentlich nur Sahra Wagenknecht im links-kommunitaristischen Bereich aktiv, wohingegen der Katja-Kipping-Flügel eher auch liberalen Kosmopolitismus machen will, um städtische, progressive Milieus zu erreichen. Insofern ist auch die Linkspartei keineswegs der natürliche Repräsentant der Links-Kommunitaristen, weil DIE LINKE in vielerlei Hinsicht momentan auch dahin drängt, zu den Grünen 2.0 zu werden.
Es scheint so zu sein, dass der Kipping-Flügel der Linkspartei die Großstädter abholen will, denen die Grünen nicht mehr links genug sind. 430.000 Menschen verlor die Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl an die AfD, sie holte mit 7,2 % deutlich mehr Stimmen im Westen und mit 17,3 % im Osten das schlechteste Ergebnis bislang. 43 Fraktionsmitglieder kommen jetzt aus dem Westen. Nur noch 26 aus dem Osten. Nach der Bundestagswahl entbrannte in der Parteizeitung Neues Deutschland ein Grundsatzstreit. Dort warb stellvertretend für den Kipping-Flügel der Bundessprecher der Linksjugend solid, Jakob Migenda, dafür links zu sein »für ein städtisches progressives Milieu«. Es ginge um die »Verankerung in progressiven und antirassistischen Bewegungen um ein Sprachrohr für ein – zunehmend prekäres! – städtisches progressives akademisches Milieu zu sein, das sich von den Grünen immer weiter entfremdet.«
Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine hingegen gerieten zeitweise nach der Bundestagswahl ziemlich in Bedrängnis, sodass selbst kurzzeitig das Scheitern der Wiederwahl von Wagenknecht als Co-Fraktionschefin möglich schien. Weder sie noch Kipping haben eine eindeutige Mehrheit innerhalb der Linkspartei, sodass diese einstweilen, ebenso wie die SPD, in der strategischen Paralyse verharren wird. In der Tendenz dominiert die öffentliche Wahrnehmung aber die Kipping-Agenda. Und die strahlt eben gerade nicht ins links-kommunitaristische Milieu hinein. Außer Wagenknecht und Lafontaine scheint also kaum einer dieses Milieu repräsentieren zu wollen. Und die AfD hat es teilweise nur sprachlich, aber eben auch noch nicht inhaltlich erreicht. Sie ist noch neoliberal und wird es vermutlich auch bleiben.
Diese Offenheit im elektoralen Raum bietet daher immer noch ein Fenster für eine Rückbesinnung im linken Lager. Noch ist dieser links-kommunitaristische Quadrant für die Linkspartei wieder eroberbar. Auch und gerade für die linke Volkspartei SPD. Damit die Volksparteien von Mitte-links bis Mitte-rechts aber aus dem Niedergang herauskommen, den sie zuletzt erlebt haben, müssen sie sich radikal ändern.
Was führte zum Niedergang?
Es ist das, was der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem aktuellen Buch Die Gesellschaft der Singularitäten die »liberale Hyperkultur« genannt hat. Er sieht diese »wirtschaftsliberal und linksliberal zugleich grundiert«. Die Verbändelung von ökonomischem Neoliberalismus und einem postmodern geprägten kulturellen Linksliberalismus war das Problem. Denn sie hat eine Krise des Politischen ausgelöst, die die bisherige Rechts-links-Achse zum Teil überflüssig gemacht hat. Auf einmal gab es einen großen Block liberaler Selbstzufriedenheit, für den par excellence Angela Merkel und Katrin Göring-Eckardt stehen und von dem sich SPD und FDP nicht groß unterscheiden – auch wenn man langsam wieder mehr Unterschiede erkennt. Diese Hyperkultur muss also politisch überwunden werden, was eine Rückkehr einer stärkeren politischen Grundsatzauseinandersetzung und damit auch das absehbare Ende der Ära Merkel bedeuten muss. Kommt es zu dieser Rückkehr, wäre ein Abgesang auf die Volksparteien verfrüht. Ein Comeback, vor allem der SPD, ist daher möglich.
Generell sollte man der Analyse von Niklas Luhmann widersprechen, der eine »funktionale Ausdifferenzierung« als naturwüchsig und als unveränderbar annimmt. Wenn man nämlich in dieser Gesinnung oder durch ein postmodernes Differenzdenken beeinflusst, Individualisierung und Ausdifferenzierung für Prozesse erklärt, die nicht aufzuhalten sind, dann kommt man auch notwendig dazu, den Weg in ein fragmentiertes Parteiensystem als unveränderbar anzusehen. Die Individualisierung ist auch nicht selbstverständlich, nicht naturwüchsig. Die postmoderne Parzellierung und Differenzierung letztlich als unüberwindbar zu behandeln und nur noch »Celebrate Diversity« zu rufen, wie etwa das Motto des Eurovision Song Contest 2017 lautete, ist nur eine Akzeptanz des Gegebenen. Wer Ausdifferenzierung für unaufhaltbar hält, der wird im Bewusstsein seiner Vielfaltseuphorie letztlich genau diese Differenzierung bestärken. Das muss alles nicht so sein. Und es sollte mit der Ausdifferenzierung auch nicht immer weitergehen. Die postmoderne Parzellierung ist falsch. Denn die Individualisierungsmaschine führt dazu, dass das Gemeinsame und Allgemeine erodiert. Der Individualisierung wird trotzdem immer weiter zugeredet. Man fordert lediglich nur Toleranz für das neue »Patchwork der Minderheiten« (Jean-Francois Lyotard). Die Folge ist aber Entfremdung, Einsamkeit und weniger Empathie und Verständnis füreinander.
In solch einer Konstellation wachsen Antagonismus und Lager. Wir und die. Das ist die Folge der postmodernen Parzellierung in der neuen liberalen Hyperkultur. Auch generelle Menschheitsziele gehen verloren. Wenn alles in Parzellen zerfällt, ist es auch einfach schwerer, sich zu einigen und zusammenzufinden. Man blickt eher mit Unverständnis auf einander. Genau das ist passiert. Gerade weil das postmoderne Denken die Hegemonie übernommen hat, sind eben nicht nur jene davon geprägt, die dieses Denken hegemonial machten und halten, sondern auch jene, die gezwungen wurden, sich innerhalb eines solchen Denkens einzureihen. So verlor etwa der Facharbeiter seine kollektive Identität als Teil der Arbeiterklasse und individualisierte sich genauso wie die postmoderne Akademikerin – die meistens Geistes- oder Sozialwissenschaftlerin ist. Weil beide nun zunächst auf sich und ihre Lebenswelt schauen, haben sie füreinander immer weniger Verständnis. Innerhalb der postmodernen Leitkultur nehmen sie sich selbst in Parzellen wahr und verlieren den Bezug zueinander und zum Allgemeinen.
Darum sind alle von der Postmoderne betroffen. Sie ist für alle auf eine diffuse Weise real. Aber vorangetrieben wird sie vor allem von einer liberalen Elite, die dieses postmoderne Denken für einen zivilisatorischen Avantgardismus hält. Der Facharbeiter und die prekär Beschäftigte sind eher Kritiker jener neuen Einheit aus Neoliberalismus und postmodernem Liberalismus. Aber sie sind trotzdem der Postmoderne und einer »liberalen Hyperkultur« ausgesetzt. Ob sie wollen oder nicht. Nun ist es aber Zeit diese Hyperkultur zu überwinden und die Parzellierung aufzuhalten. Es geht darum, universalistische Ziele zu setzen und sie energisch zu verfolgen. Das gilt insbesondere für die Linke. Einseitig ein liberales Großstadtbürgertum mit einem postmodernen Liberalismus anzusprechen, ist daher falsch, weil das die Gräben in der Gesellschaft nur noch weiter aufmacht. »Zusammenhalt«, der zuletzt so oft von der SPD beschworen wurde, lässt sich nur mit einer dezidiert linken Politik wieder stärken, die sowohl die »soziale Frage« stellt, als auch klar und deutlich die Probleme benennt, die den Menschen auf den Nägeln brennen.
Um nicht lediglich und einseitig liberale Modernisierer anzusprechen und damit im Grunde nur Politik im Sinne eines postmodernen Partikularismus zu machen, sollte also vor allem die SPD dringend dorthin gehen, »wo es brodelt, riecht und stinkt«, wie es Sigmar Gabriel der Partei einst bei seiner Antrittsrede als SPD-Vorsitzender empfohlen hatte. Damit wird sie nicht nur die verwaisten Wähler des links-kommunitaristischen Quadranten erreichen, sondern sehr viele Konservative, die vom Sonnenscheinliberalismus Angela Merkels genug haben. Nur eine Politik auf Augenhöhe, die artikuliert, wo Menschen der Schuh drückt, sie ernst nimmt und sie nicht belehrt und zu einem Weltbild zwingt, kann die kommunitaristische Lücke schließen. Ein »linker Realismus« könnte das schaffen.
Nun ist es aber auch so, dass man auch Linke, die nach einer neuen Vision und einer neuen Gesellschaft verlangen, mit einem neuen linken Realismus erreichen kann. Aber auch nur dann, wenn dieser zugleich mit einem neuen linken Idealismus verbunden ist. Das »Ende der Geschichte« (Francis Fukuyama) ist noch nicht erreicht. Das ist noch nicht die beste aller Welten. Und deswegen muss die Linke alles tun, um deutlich zu machen, dass sie mit dieser Welt noch nicht zufrieden ist.
Mein Plädoyer an die Linke, wozu ich mittlerweile weniger die Grünen zähle, sondern vor allem SPD und Linkspartei, ist somit, dass sie sehr zentral dem Eindruck entgegenwirken muss, dass alles gut ist und wir nur noch kleine Problemchen hätten. Große Teile der SPD, der Grünen, eben sogar der Kipping-Flügel der Linkspartei, bis zum Merkel-Flügel der CDU wollten zuletzt für ihre Sichtweise auf die Welt gewählt werden. Aber das ist einfach zu wenig. Und es ist auch eine Art Moral-Konservatismus. Dabei kam rüber: Wir finden diese Welt schon ganz gut so. Vor allem für die Linke ist so ein Eindruck fatal, sie muss vielmehr für eine solidarische Zukunft kämpfen. Für alle.
So eine Partei gab es im linken Bereich zuletzt nicht. Dahin muss insbesondere die SPD aber wieder kommen. Die Linke sollte sich daran erinnern, was sie einmal angetrieben hat. Ich nenne das ihren »geschichtsphilosophischen Auftrag«, sie muss den Kampf für eine neue Weltordnung auf sich nehmen. Sie muss »Liebe zur Welt« beweisen. Aber das mit Realismus.
Und wenn die Linke diesen Kampf für eine neue Weltordnung auf sich nimmt, dann hat sie eine Chance für eine Renaissance. For the many, not the few.
(Dieser Text basiert auf dem vom Autor kürzlich bei J. H. W. Dietz veröffentlichten Buch: »Die liberale Illusion. Warum wir einen linken Realismus brauchen«. Bonn 2018, 352 S., 22 €.)

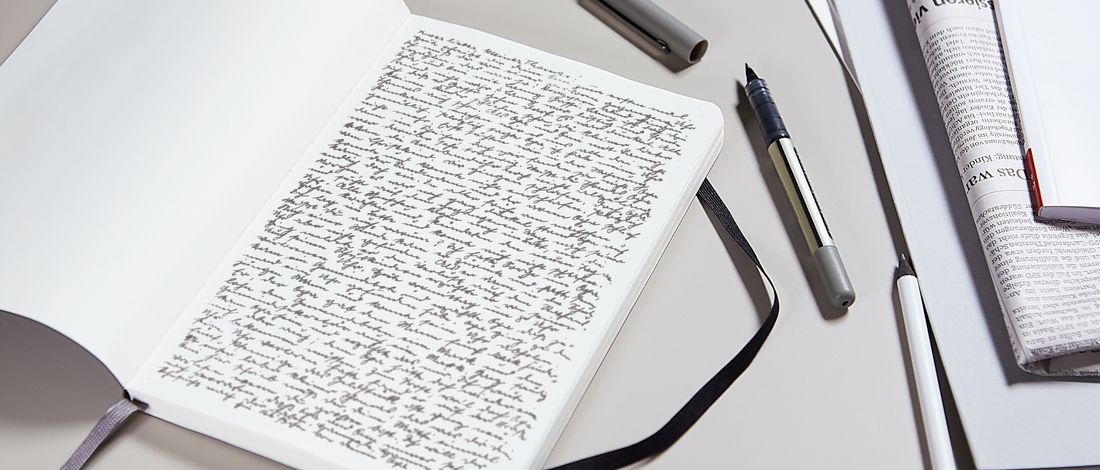


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!