Für großes Aufsehen hat dieses Datum in den zurückliegenden Jahren nicht gesorgt: Jeweils vier Tage vor Heiligabend, am 20. Dezember, begehen die Vereinten Nationen ein Fest anlässlich des »Internationalen Tages der menschlichen Solidarität«. Seit 2005 gibt es diesen – er ist ein symbolisches Überbleibsel der UN-Millenniumsziele.
»Die globalen Probleme«, heißt es dort, »müssen so bewältigt werden, dass die damit verbundenen Kosten und Belastungen im Einklang mit den grundlegenden Prinzipien der Billigkeit und sozialen Gerechtigkeit aufgeteilt werden. Diejenigen, die leiden oder denen die geringsten Vorteile entstehen, haben ein Anrecht darauf, Hilfe von den größten Nutznießern zu erhalten.« Solidarität also als eine der zentralen globalen Wertideen – neben Toleranz, Freiheit und der Achtung der Natur. Das klingt so selbstverständlich. Und ist es doch überhaupt nicht, denn: Harmonisch oder widerspruchsfrei war diese Geschichte der Solidarität nie.
Natürlich, wer wünschte sie sich nicht, eine solidarische Gesellschaft. Im »Zeitalter der Ungewissheit« (Herfried Münkler) klingt der Ruf nach Solidarität jedenfalls besonders laut. Vielfach ist zu spüren, wie sehr diese Sehnsucht verbunden ist mit der Hoffnung auf eine neue Form gesellschaftlichen Zusammenrückens: Junge helfen Alten, Gesunde den Kranken, die Stärkeren schultern die Sorgen der Schwachen.
Inzwischen jedoch ahnen viele, dass die aktuelle Coronakrise neue und alte Ungleichheiten verschärft. Solidarität ist Ausdruck einer wechselseitigen Beziehungsweise, die das Voneinander-abhängig-Sein in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Doch was genau heißt das? Richtet sich der Blick mehr auf soziale Formen der Solidarität, Funktionsweisen gesellschaftlicher Integration oder rückt die politische Solidarität, die alten (und neuen) Kämpfe in den Mittelpunkt, die mit dem Begriff immer verbunden waren und es heute noch sind? Geht es um partikulare oder universelle Deutungen der Solidarität, um institutionelle oder individuelle Normen, um Solidarität als reziprokes Verhältnis – und wie steht es mit den Grenzen der Solidarität, den sozialen, geschlechtsspezifischen oder rassistischen Abgrenzungen, die oft mitschwingen, über die aber nur ungerne gesprochen wird?
Zukunftsbilder sind keine statische Größe, und an ihren Wandlungen und Konjunkturen lassen sich zentrale gesellschaftliche Konfliktlinien und Selbstdeutungen ablesen. Für die frühe Arbeiterbewegung war der Bezug zur Solidarität Ausdruck akuter Ausbeutungserfahrungen im Kapitalismus. Sie gebrauchte diesen Begriff auch, um sich damit von den älteren Ideen der christlichen Güte und Barmherzigkeit abzugrenzen.
Für Wilhelm Liebknecht schien die Solidarität sogar zum »höchste[n] Kultur- und Moralbegriff« der Arbeiterbewegung geworden zu sein. Und für Kurt Eisner entfalte dieser Begriff erst in den Trümmern der alten obrigkeitsstaatlichen Ordnung seine ganze Kraft. Die Solidarität, da war er sich sicher, werde der »Baumeister einer ganz erhabenen Weltordnung« sein. Der Begriff meine eben »mehr als das erniedrigende Mitleid, auch mehr als die erhöhende Liebe.« Sie sei ein »kalte[s], stahlharte[s]« Wort, geglüht im »Ofen des wissenschaftlichen Denkens«.
»Die Solidarität hat ihre Wiege im Kopf der Menschheit, nicht im Gefühl. Wissenschaft hat sie gesäugt, und in der großen Stadt, zwischen Schlöten und Straßenbahnen ist sie zur Schule gegangen. Noch hat sie ihre Lehrzeit nicht abgeschlossen. Ist sie aber reif geworden und allmächtig, dann wirst Du erkennen, wie in diesem harten Begriff das heiße Herz einer Welt von neuen Gefühlen und das Gefühl einer neuen Welt leidenschaftlich klopft.« Kurt Eisner hatte bereits 1909 manche der Ambivalenzen, die in der Geschichte und sozialen Praxis der Solidarität stecken, beschrieben: Die Sehnsucht nach klassenspezifischen Bindekräften, die sich gleichsam »natürlich« ergeben; die utopische Kraft einer gesellschaftlichen Ordnung, die nationale Grenzen überwindet und den Grad ihrer Verpflichtung aus den Erfahrungen sozialer Kämpfe entwickelt. Manch hohle Propaganda und rhetorisches Muskelspiel haben den Begriff begleitet. Und doch ist seine emotionale Anziehungskraft in der Arbeiterbewegung erstaunlich – eine Idee, die immer auch mit einer Vorstellung von »Fortschritt« verbunden war.
Von einem »neuen Fortschritt« spricht auch die Ampelregierung. Dagegen ist von Solidarität im neuen Koalitionsprogramm kaum die Rede. An zwei Stellen taucht der Begriff auf: »Gemeinsinn, Solidarität und Zusammenhalt« seien neu im veränderten Deutschland zu bestimmen; ein zweites Mal findet der Begriff seinen Platz im Teil über die Außenpolitik. Viel ist das nicht.
Wer den Umgang mit der »Solidarität« in der politischen Sprache der Sozialdemokratie verfolgt, wird über diese vornehme Zurückhaltung nicht verwundert sein. Schon im Wahlkampf ging es mehr um Respekt, weniger um Solidarität. Unmittelbar nach dem letzten Regierungsantritt der damals rot-grünen Koalition hatten sich Teile der Sozialdemokratie schon einmal auf die Suche nach der neuen Bedeutung gemacht, die die Grundwerte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert spielen könnten.
Rudolf Scharping machte bei einer Veranstaltung im November 2000 in Berlin den Aufschlag, um den alten Begriff der »Solidarität« zu neuem Leben zu erwecken. »Solidarität«, so Scharping, sei die »gemeinsam wahrgenommene gegenseitige Verantwortung – ausgedrückt in Begriffen von Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Gemeinwohl, oder, wie John Rawls, der oft als liberal missverstandene amerikanische Kommunitarist es einmal genannt hat: die gesellschaftlichen Grundgüter«. Solidarität werde zerrieben, so seine Diagnose, »zwischen weltweiter ökonomischer Verflechtung einerseits und innerstaatlicher, gesellschaftlicher Individualisierung andererseits. Wo soll noch Solidarität herkommen, wenn auf der einen Seite die ökonomischen Interessen sich weltweit organisieren und auf der anderen Seite die Gesellschaften selbst sich immer stärker individualisieren.«
Scharping markierte aus seiner Sicht einige gängige Missverständnisse, die mit der »Solidarität« verbunden seien. Solidarität war für ihn mehr als nur die Unterstützung der Schwachen durch die Stärkeren und meinte auch nicht nur den Zusammenschluss der Unterdrückten.
Solidarität beschreibe – im Sinne Rawls – ein Prinzip der Verantwortung und die »Teilhabe an den gesellschaftlichen Grundgütern«. Solidarität habe immer eine zeitliche Dimension und zwinge dazu, Entscheidungen über künftige Entwicklungen zu treffen. Solidarität brauche angesichts der ökonomischen Globalisierung und des europäischen Integrationsprozesses eine neue Begründung. Der alte Nationalstaat reiche indes nicht mehr als Ordnungsmodell solidarischer Beziehungen aus.
Scharping warb zudem für eine Vorstellung von Solidarität, die es denkbar werden ließ, den Bezugskreis von Solidarbeziehungen nicht nur auf Menschen, sondern auch auf den Umgang mit natürlichen Ressourcen, auf Umwelt und Natur zu beziehen. Und schließlich erinnerte er an die Tradition der »praktischen Solidarität« innerhalb der Sozialdemokratie, die Geschichte von Konsum- und Baugenossenschaften und anderen Organisationen der Arbeiterselbsthilfe.
Das war ein ebenso knappes wie bemerkenswertes Statement – bemerkenswert in seinen Bezügen, aufschlussreich, in dem, was es nicht thematisierte. Auf der Suche nach einem der programmatischen Kerne der Solidarität lehnte sich Scharping jedenfalls nicht bei dem einen oder anderen sozialistischen Klassiker, auch nicht bei den ersten, zaghaften Versuchen innerhalb des Godesberger Programms an, den Begriff der Solidarität mit Inhalt zu füllen.
Waren 1959 die proletarischen Lebenszusammenhänge, Streik- und Widerstandserfahrungen der ersten Jahrhunderthälfte noch durchaus spürbar, so flackerten sie bei Rudolf Scharping nur noch als historische Reminiszenz auf. Eine lebensweltliche Prägekraft hatte Solidarität nicht mehr, waren doch die alten sozial-moralischen Milieus weitgehend verschwunden. Dass sich der ehemalige SPD-Vorsitzende und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ausgerechnet auf John Rawls und die Ideengebäude des Kommunitarismus bezog, wird wohl nur vor den gleichzeitigen Debatten um einen »Dritten Weg« verständlich, sowie einer Annäherung von Liberalismus und Sozialdemokratie.
Dass Scharping den amerikanischen Philosophen gegen jene verteidigte, die ihn als »Liberalen« attackierten und seine kühle Rationalität in der Begründung von Freiheitsrechten für allzu formal hielten, war eine eigentümliche Wendung sozialdemokratischer Denktradition, die sich Mitte der 90er Jahre vollzog. Viel war von »Verantwortung« die Rede, der Kraft des »zivilisatorischen Modells Europa«, seiner »tragenden Pfeiler« von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Freiheitswillen und Eigenverantwortung.
Begriffliche Revitalisierung
Solidarität als Erfahrung politischer Kämpfe, von Macht- und Interessenkonflikten in kapitalistischen Gesellschaften spielte dagegen kaum mehr eine Rolle und machte den Wandel deutlich, den der Begriff im sozialdemokratischen Wertehimmel erfahren hatte. Dass sich der Bedeutungskern der Solidarität verändert hatte, schien in den 90er Jahren kaum mehr jemand innerhalb der Sozialdemokratie bezweifeln zu wollen. Die Leitidee der Solidarität war dabei nicht etwa verschwunden. Sie hatte aber doch ihre Form verändert. Im Hamburger Programm von 2007 fanden sich einige Versatzstücke, und doch brauchte es wohl noch erst die Erfahrungen der Finanzkrise und weitere bittere Wahlniederlagen, bis die Sozialdemokratie mit Andrea Nahles an der Spitze neu darüber nachzudenken begann, wie sie ihre Vorstellung von Solidarität revitalisieren könnte.
Ihre Zeit an der Spitze der SPD war nur kurz, viel zu kurz für ein längerfristiges Erbe, und doch war es Nahles, die mit einiger Leidenschaft dafür warb, den Begriff neu zu konturieren – und dadurch gegen die »alte« soziale, auf die jüngere Idee einer »solidarischen« Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert setzte; eine Akzentverschiebung, die insbesondere auf eine aktivere Rolle des Staates und die Regulierung des digitalen Kapitalismus abzielte. Dass die »Solidarität« nun auch Gegenstand intensiver Debatten der »Grundwertekommission« wurde, hing nicht zuletzt auch mit den Impulsen der Parteivorsitzenden und der begonnenen Suche nach einer vorsichtigen programmatischen Neujustierung als Lernerfahrung aus der Finanzkrise zusammen.
Praktiken der Solidarität, auch das wird in den programmatischen Debatten der Sozialdemokratie deutlich, haben sich verändert. Sie sind stärker Ausdruck individueller Entscheidungen geworden. Zugleich verweist der Begriff aber beständig auf die ungelösten Probleme kapitalistischer Gesellschaften, auf die Widersprüche der Krisenbewältigung, neue und alte Konkurrenzen, blinde Stellen, auch innerhalb gerade einer inzwischen wieder recht eng und national denkenden politischen Linken, die noch nach Antworten sucht auf die ökologisch-sozialen Ungleichheitsverhältnisse des Klimawandels.
Das Unbequeme, das diesem Begriff innewohnt, seine Zumutungen, seine Grenzen sprengende, gesellschaftskritische Perspektive lässt vor allem eines klar werden: Sie machen das Besondere dieses vielfach so weichgespülten Begriffes aus – ein Grund mehr, ihn bei der Suche nach den künftigen gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen und Visionen nicht zu vergessen.

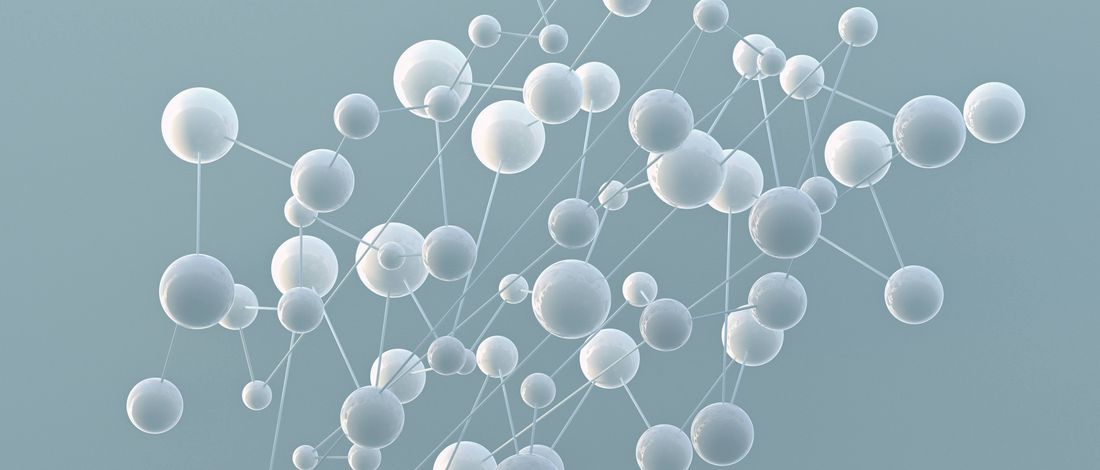


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!