Bei der kommenden Bundestagswahl geht es – auch – um die Zukunft unserer Demokratie. Ist das eine alarmistische Übertreibung? Beteuern doch alle, versichern wir es uns doch immer wieder wechselseitig: Die Demokratie in Deutschland ist nicht in Gefahr, wir leben in einem politisch besonders stabilen Land, es gibt keinen Anlass für Unruhe, Krisenstimmung oder gar Alarmismus. Das gelte trotz terroristischer Anschläge, trotz rechtsextremistischer Gewalt (die in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat), trotz des linksextremistischen Gewaltexzesses in Hamburg zuletzt. Wir leben schließlich in einem wirtschaftlich erfolgreichen, wohlhabenden Land mit einer gefestigten, selbstverständlich gewordenen Demokratie, mit einem verlässlichen Rechtsstaat, einem einigermaßen gut funktionierenden Sozialstaat. Gewiss, gewiss.
Warum aber zeigen dann alle Stimmungsabfragen der letzten Jahre das gleiche zwiespältige Bild? Eine große Mehrheit der Deutschen meint, dass es ihnen gut gehe. Eine ebenso große Mehrheit aber äußert zugleich die Befürchtung, dass es nicht so bleiben könnte, dass es uns nicht weiterhin und dauerhaft so gut gehen werde. Und dass der Wohlstand ungleich verteilt sei. Mit der positiven ökonomisch-sozialen Gegenwartsbeurteilung korrespondieren auf eigentümliche Weise eine starke Zukunftsunsicherheit und das Empfinden sozialer Ungerechtigkeit.
Für diesen Zwiespalt gibt es Gründe. Wir leben in einem reichen Land, aber der Reichtum ist höchst ungleich verteilt. Die Einkommensunterschiede, die Gegensätze zwischen Arm und Reich sind in den letzten 30 Jahren deutlich gewachsen – nicht nur, aber auch in unserem Land. Deshalb lautet das Wahlkampfmotto der SPD zu Recht: »Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit«. Sozialdemokratische Gerechtigkeitspolitik konzentriert sich dabei nicht (gewissermaßen traditionalistisch) auf Verteilungsgerechtigkeit. Sie begreift viel mehr (Investitionen in) Bildung, Forschung, Infrastruktur, Geschlechterpolitik, Arbeitszeitpolitik, Sicherung und Weiterentwicklung des Sozialstaates und nicht zuletzt Steuerpolitik als wesentliche Felder von Gerechtigkeitspolitik. Genau das ist vernünftig und zukunftsgerichtet. Was das im Einzelnen an Vorschlägen und Maßnahmen umfasst, ist im sozialdemokratischen Regierungsprogramm 2017–2021 detailliert nachzulesen.
Woher aber kommt die von so vielen Menschen empfundene Zukunftsunsicherheit, worin gründet das vielfach artikulierte demokratische Krisenempfinden, die verbreiteten Zweifel und die hör- und sichtbare Distanz gegenüber dem demokratischen System, der grassierende Diskurs über die Krise der repräsentativen Demokratie und die Vertrauenskrise der Volksparteien? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu den passenden Titel: Gespaltene Mitte. Feindselige Zustände. Wie sehr sich die Stimmung (und die Lage) verändert, ja verfinstert hat, verdeutlicht eine Erinnerung. Etwa ein Vierteljahrhundert ist das alles erst her: die friedliche Revolution, die Überwindung des Ost-West-Systemkonflikts, die Vereinigung Deutschlands und die Überwindung der Spaltung Europas. Welche Euphorie existierte damals, welche Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter des Friedens! Das Ende der Geschichte, der endgültige Sieg der Demokratie wurde von dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama verkündet. Welch ein Kontrast zur Gegenwart! Was ist inzwischen passiert? Ich vergegenwärtige im Folgenden holzschnittartig einige Fakten und Entwicklungen.
Erstens: Wir haben in Deutschland und Europa in den vergangenen beiden Jahren erlebt, wie sich durch die Fluchtbewegung die politische Tagesordnung und die gesellschaftliche Stimmung verändert haben. Es ist noch nicht wirklich absehbar, welche langfristigen Wirkungen die nun nicht mehr zu leugnende Tatsache haben wird, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Vermutlich werden sie folgenreicher sein als die Wirkungen der deutschen Wiedervereinigung.
Zweitens: Diese Fluchtbewegung ist selbst Teil eines umfassenderen Prozesses, den wir mit dem Schlagwort »Globalisierung« bezeichnen. Gemeint sind damit Entgrenzung und Beschleunigung der ökonomischen Entwicklung, der internationalen Arbeitsteilung, des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, insgesamt eine rasante Dramatik vielfältiger Veränderungen.
Drittens: Mit und seit der Finanzmarktkrise erleben wir die Schattenseite der Globalisierung, vor allem eine Verschärfung sozialer Gegensätze, der Unterschiede zwischen Arm und Reich auch in Deutschland. Selbst das Weltwirtschaftsforum, sozialdemokratischer Gesinnung gewiss nicht verdächtig, beklagt die wachsende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit als eine der großen Gefahren für die Welt.
Viertens: Viele erleben die Globalisierung als Gefährdung, ja als Verlust des Primats demokratischer Politik gegenüber den Märkten, gegenüber finanzökonomischer Macht. Sie erleben Politik als atemloses Hinterherhetzen hinter finanzökonomischen Prozessen und Entscheidungen.
Fünftens: Ein Gefühl des Verlustes an Kontrolle über das eigene Schicksal, die eigene Zukunft, breitet sich dramatisch aus. Abstiegsängste und Zukunftsunsicherheit nehmen gerade auch in den sozialen Mittelschichten zu.
Sechstens: Dieses Gefühl wird verstärkt durch den sich beschleunigenden Prozess der Digitalisierung vor allem der Arbeitswelt. Die weitere Entwicklung der Digitalisierung und ihre Konsequenzen sind noch nicht vollständig überschaubar, deren politische, rechtliche und soziale Gestaltung hinkt – erklärlicherweise – hinterher. Die Zukunft der Arbeit, also die der Arbeitsbiografien ist fragil, ist unsicher.
Siebtens: Der islamistische Terrorismus, alte und neue, ungelöste und unlösbar erscheinende kriegerische Konflikte, die Schwäche der internationalen Organisationen (vor allem der UNO), die Krise der EU (mit dem Brexit als Menetekel), runden das beunruhigende Bild ab. Das alles vermittelt den irritierenden Eindruck einer Weltunordnung. »Die Welt ist aus den Fugen« hat Frank-Walter Steinmeier treffend bemerkt. »Die Welt wird neu vermessen« beschreibt die Situation nur wenig freundlicher.
Achtens: Wir erleben die Wiederkehr alter Geister – des Nationalismus, des Rassismus, der autoritären Politik. Was für eine Welt, die von Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan und Donald Trump, der demokratische Wahlen mit Chauvinismus, Rassismus und Sexismus gewonnen hat, beherrscht wird!
Ein vertrauter, gefährlicher Mechanismus wird wieder sichtbar und wirksam: Je komplexer und bedrohlicher die Problemfülle erscheint, umso stärker das Bedürfnis nach den einfachen Antworten, umso stärker die Sehnsucht nach den schnellen Lösungen, ja nach Erlösung, nach der starken Autorität. (Wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte.) Das ist die Stunde der Populisten, der großen und kleinen Vereinfacher und Verfeinder. Wir erleben sie in unserer Nachbarschaft: in den Niederlanden und Frankreich, in Ungarn und Polen, in Österreich und Italien und eben auch in Deutschland mit der AfD.
Schauen wir uns um: Die liberale, offene, pluralistische, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Demokratie ist nicht (mehr) die Regel, sie ist eher die Ausnahme. Sie ist ein zerbrechliches politisches System, sie erweist sich als gefährdet, selbst in Europa. Der Blick nach Polen, nach Ungarn, nach Russland erinnert an eine beunruhigende historische Erfahrung: »Zur Abschaffung von Demokratie eignet sich nichts besser als Demokratie«, so hat es Peter Sloterdijk in der ZEIT bemerkt.
Weil die Demokratie eben nicht mehr selbstverständlich, sondern gefährdet ist, fordert das zu ihrer aktiven Verteidigung heraus, gegen das, was man Krise der Parteiendemokratie oder Vertrauenskrise der Volksparteien nennt. Gerade auch gegen das, was viele zu Recht als Vergröberung der kommunikativen Sitten erleben: Lügen halten als »alternative Fakten« Hof, die sozialen Medien werden immer mehr zu Echoräumen der eigenen Vorurteile, der Entladung von Hass und der Steigerung von Aggressivität.
Wird sich angesichts all dessen, das ist die beunruhigende Frage, unsere Demokratie in Deutschland und in Europa bewähren und behaupten oder sich etwa als »Schönwetterdemokratie« erweisen? Darum geht es im Wahljahr 2017, einem Jahr, das mit dem polternden Amtsantritt des US-amerikanischen Präsidenten von Anfang an bedrohliche Züge angenommen hat.
Wir bemerken gegenwärtig, dass sich die deutsche Gesellschaft insbesondere durch Migration stark verändert. Sich auf diese Veränderung einzulassen, ist offensichtlich eine anstrengende Herausforderung. Sie erzeugt Misstöne und Ressentiments und macht vielen (Einheimischen) Angst, vor allem unübersehbar und unüberhörbar im östlichen Deutschland. Pegida ist dafür ein schlimmes Symptom, die Wahlerfolge der AfD sind ein anderes.
Vertrautes, Selbstverständliches, soziale Gewohnheiten und kulturelle Traditionen: Das alles wird unsicher, scheint gar verloren zu gehen. Individuelle und kollektive Identitäten werden infrage gestellt – durch das Fremde und die Fremden, die uns nahe gerückt sind, durch die Globalisierung, die offenen Grenzen, die Zuwanderer, die Flüchtlinge. Die Folgen sind Entheimatungsängste, die sich in der Mobilisierung von Vorurteilen, in Wut und aggressivem Protest ausdrücken und eben auch in Rassismus und Gewalt. Genau das ist unsere demokratische Herausforderung und sie ist eine politische wie moralische: dem rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Trend, der sichtbar stärker und selbstbewusster geworden ist, zu begegnen, zu widersprechen, zu widerstehen. Die Wahlergebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Berlin im vorigen Jahr sind Beunruhigung und Aufgabe genug. Und die Wahlergebnisse im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind keine wirkliche Beruhigung. Die Wahlergebnisse in den Niederlanden und in Frankreich auch nicht.
Wie lautet die den Bürgern mögliche Antwort auf die autoritäre Gefährdung, die populistische Herausforderung unserer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie? Es gilt, sich einige Selbstverständlichkeiten wieder bewusst zu machen. Zunächst und vor allem: Die Verteidigung dieser Demokratie ist Sache der Bürger und nicht nur »derer da oben«, der Parteien, des Staates. Das mindeste ist (und das ist eigentlich trivial): Wählen gehen und zwar demokratische Parteien! Für jemanden, der Jahrzehnte auf die Möglichkeit, frei wählen zu können, hat warten müssen, ist das allerdings immer noch nicht trivial. Gerade in Ostdeutschland aber ist die Wahlbeteiligung niedrig und sind die Ergebnisse für das rechtspopulistische Angebot besonders hoch. Eine gefährliche Entwicklung. Auch anderswo sieht es nicht gut aus: An der Brexit-Entscheidung haben vor allem junge Wähler nicht teilgenommen, bei der französischen Präsidentschaftswahl lag die Wahlbeteiligung unter 50 %.
Wir müssen wieder begreifen, wie wenig selbstverständlich und felsenfest gesichert die Demokratie ist, wie der Blick in die Welt zeigt. Sie ist ein politisches System, das in ständiger Anstrengung immer wieder neu gelernt, immer wieder neu angeeignet werden muss. Die Demokratie garantiert nicht ökonomischen Erfolg, Wohlstand und Gerechtigkeit. Aber sie ist als rechtsstaatliche Demokratie die politische Lebensform der Freiheit – die das Streben nach Wohlstand und Gerechtigkeit, möglichst für alle, ermöglicht. Das ist pathetisch formuliert. Nüchtern umschrieben ist Demokratie ein Regelwerk und ein Institutionengefüge – zum Erwerb, zur Begrenzung und zur Kontrolle von politischer Gestaltungsmacht, zur Übertragung von Verantwortung für die Regelung von gemeinschaftlichen Angelegenheiten, zur Vertretung von je eigenen Meinungen und Interessen. Demokratische Vertretungsmacht und Gestaltungsverantwortung werden in ihr durch geregelte Verfahren legitimiert. Demokratie ist deshalb eben nicht einfach Volksherrschaft oder Herrschaft der Mehrheit, wie ein weit verbreitetes Missverständnis meint. Zur liberalen rechtsstaatlichen Demokratie gehören unabdingbar Gewaltenteilung, ein System der checks and balances, die Unabhängigkeit der Justiz, der freien Presse, der Schutz der Opposition, die Grundrechte der Individuen. Ohne sie wird Demokratie autoritär und illiberal, wie man in Ungarn, der Türkei und anderswo beobachten kann.
Das Regelwerk und Institutionengefüge blieben leer und abstrakt, wenn sie nicht in Anspruch genommen würden, wenn sich in ihnen nicht die Bürger als Demokraten engagierten! Dieses Engagement verlangt einige elementare Eigenschaften bzw. Tugenden (und erzeugt diese auch): Orientierung auf das Gemeinwohl, Kompromissbereitschaft und Konsensfähigkeit, die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, also sein Gesicht zu zeigen. In der Anonymität zu bleiben, sich in der Haltung des Schimpfens und Jammerns einzurichten, die Opferrolle zu pflegen – das sind Untugenden einer Zuschauerdemokratie. Die wirkliche Demokratie ist eben doch keine politische Talkshow, so sehr diese die Suggestion des demokratischen Dabeiseins zu erzeugen vermag. Demokratie verträgt sich nicht mit autoritären Einstellungen und Erwartungen – an die prompte, schmerzfreie Lösung der bedrückenden Probleme, gar an Erlösung von der Problemlast.
Gewiss ist Demokratie Streit. Und zwar friedlicher Streit nach Regeln der Fairness. In ihm soll es um den Austausch von Argumenten gehen, um den Wettstreit inhaltlicher wie personeller Alternativen. Genau deshalb sind Wahlkampfzeiten Hoch-Zeiten der Demokratie. Sie sollten es jedenfalls sein. Aber wie kann das gelingen, wenn die amtierende Bundeskanzlerin als Spitzenkandidatin von CDU/CSU diesen inhaltlichen Streit verweigert, jeder klaren alternativen Positionsbestimmung aus dem Weg geht? Wird die bereits in früheren Wahlkämpfen praktizierte Strategie der »asymmetrischen Demobilisierung« wieder erfolgreich sein? Und wer kann eigentlich das Motto der Kanzlerin noch glauben: »Sie kennen mich!« Kennen die Wähler sie wirklich? Wie oft schon hat Angela Merkel nach den Wahlen etwas anderes getan, als sie vor der Wahl angekündigt hatte. Wie viele Kehrtwendungen hat sie schon vorgenommen: Abschaffung der Wehrpflicht, Atomausstieg, Handling der Eurokrise, Grenzöffnung für Flüchtende, zuletzt die »Ehe für alle«. Ist das unausweichlicher, gar bewundernswerter Pragmatismus oder nicht viel mehr Politik aus dem Handgelenk? Verlässlichkeit und zukunftsorientierte Politik über den Tag hinaus ist es jedenfalls nicht. Und wie wenig hat die Kanzlerin ihre jähen politischen Wendungen erklärt oder gar aus Grundüberzeugungen abgeleitet. Welche Politik sie macht, das ist bestimmt durch die Koalition, in die sie durch Wahlen gezwungen wird, und durch den Druck, dem sie jeweils nachgeben zu müssen meint.
Niemand kann also wissen, welche Politik sie nach der Wahl machen wird! Demokratische Wahlen aber verlangen die Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit der wählbaren Alternativen. Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz haben ihr Programm vorgelegt, ihre Positionen in einem Zehn-Punkte-Programm zugespitzt. Die Wähler können also wissen, woran sie mit der SPD und mit Martin Schulz sind. Angela Merkel dagegen entzieht sich systematisch der Konfrontation. Das mag ihr nutzen (wenn es sich die Wähler gefallen lassen), aber es schadet zugleich der Demokratie, die vom fairen Streit und der Deutlichkeit der alternativen Angebote lebt und damit den Wählern die Chance zu einer sachgerecht-souveränen Entscheidung ermöglicht. »Angela Merkels Vorstellung vom Wähler ist offenbar die des Staatsbürgers im Laufstall, eines zu behütenden Mitmenschen, dem man nicht zu viel zumuten darf«, so hat es Gerd Appenzeller kürzlich im Berliner Tagesspiegel formuliert. Man sollte der Kanzlerin die Verweigerung von Wahrheit und Klarheit nicht wieder durchgehen lassen.

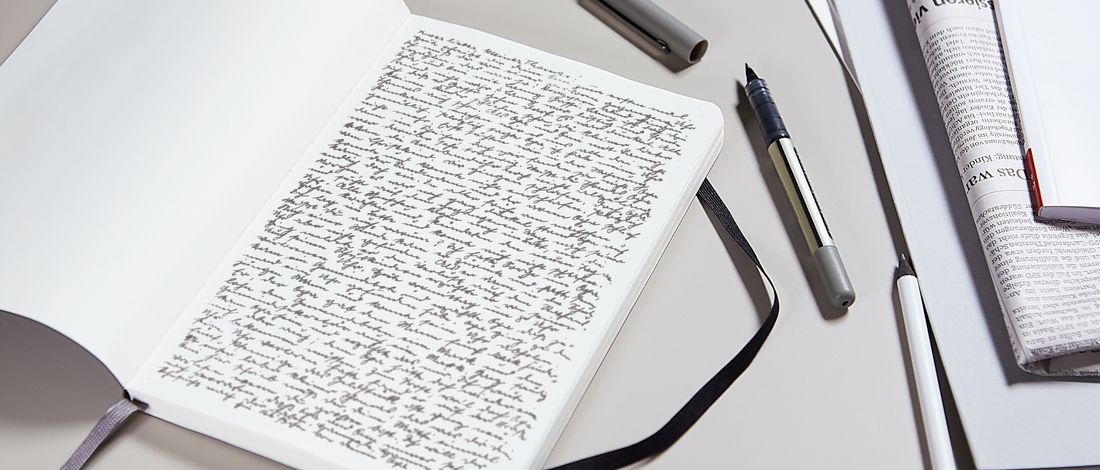


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!