NG FH: Identitätspolitik wurde in den Politikwissenschaften und im öffentlichen Diskurs einflussreich, besonders mit Blick auf die USA: »Me too«, »Black Lives Matter«, der Trumpismus und »Make America great again«. »Was früher die Konfession war, später die Ideologie wurde, ist heute Identität, das erfolgversprechendste Mittel, um Zugehörigkeit zu signalisieren«, so der FAZ-Redakteur Simon Strauß. Was ist an der Behauptung dran, dass Fragen von Kultur und Zugehörigkeit unsere Gesellschaften mittlerweile mehr spalten als verteilungspolitische Gerechtigkeitsfragen?
Wolfgang Thierse: Dieser Eindruck ist unabweisbar, Fragen der kulturellen, ethnischen, geschlechtlichen und sexuellen Identitäten spielen mindestens im Feuilleton eine dominante Rolle. Dazu gehören auch die Debatten über Rassismus, Postkolonialismus, Gender. Das sind, denke ich, unausweichliche Debatten in einer pluralistischen Gesellschaft. Sie sind Ausdruck unvermeidlicher sozialer Konflikte, die als Verteilungskonflikte um Sichtbarkeit und um Einfluss, um Aufmerksamkeit und um Anerkennung, also um kulturelle Teilhabe ausgefochten werden.
So unvermeidlich diese Konflikte erscheinen mögen, so verwirrend, unübersichtlich und ambivalent sind sie auch. Die Heftigkeit mancher Attacken aufs Hergebrachte, ebenso wie die Heftigkeit der Verteidigung des Hergebrachten, die Radikalität einiger identitärer Forderungen überdecken allerdings die Tatsache, dass auch die Gegenwart grundlegend durch soziale und ökonomische Konfliktkonstellationen bestimmt ist, von denen die kulturellen Kämpfe allerdings ein deutlich sichtbarer Teil sind.
NG FH: Doch sind kollektive Identitäten eigentlich immer problematisch? Auch die historische Arbeiterbewegung (als »Klasse für sich«) war im Grunde identitätspolitisch unterwegs und es ist nicht nur negativ von ostdeutscher Sonderidentität gesprochen worden.
Thierse: Na ja, weder kollektive noch gar individuelle Identitäten sind per se etwas Schlechtes, wenn sie nicht aus oder durch Verengung und Ausgrenzung gewonnen werden und wenn sie nicht der Verengung und Ausgrenzung dienen. Die Verständigung über die je eigene, die verschiedenen Individuen verbindende soziale Lage und die daraus resultierenden Interessen ist ja notwendig. Aber das ist nicht gleich Identitätspolitik. In der Arbeiterbewegung ging es mit dem Ziel der Verbesserung der eigenen Lage, der sozialen und ökonomischen Gleichberechtigung, um eine Änderung von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft insgesamt. Das war immer mehr als Identitätspolitik, unter dem programmatischen, vielleicht illusorischen Anspruch: die Befreiung der Arbeiterklasse ist die Befreiung der Gesellschaft.
NG FH: Also sind Radikalisierung, fundamentalistische Politisierung und Instrumentalisierung von Kulturen und Religionen die Probleme, was Thomas Meyer »Identitätswahn« nannte. Vernunft und Demokratie, der Austausch von Argumenten und Kompromissen werden so unmöglich. Oder ist dies übertrieben formuliert?
Thierse: Das ist es wohl nicht. In einem Interview mit den Gründern und Chefs von Biontech, jener Forschungsfirma, auf die wir jetzt so viel Hoffnung setzen, sagte Özlem Türeci: »Identifikation ist nichts Negatives, nur die Politisierung von Identität ist schädlich«. Das sagt eine erfolgreiche türkischstämmige Deutsche. Die mich – im Sinne von Meyer – beschäftigende Frage ist, wie viel Identitätspolitik für Minderheiten stärkt die Pluralität einer Gesellschaft, ab wann schlägt sie in eine Spaltung der Gesellschaft um? Sehr grundsätzlich gesagt: ethnische, kulturelle, religiös-weltanschauliche Pluralität, die auch in Deutschland zunehmen wird, ist keine Idylle, sondern ist voller Streit und Konfliktpotenzial. Wenn Vielfalt friedlich gelebt werden soll, dann muss diese Pluralität mehr sein als das bloße Nebeneinander oder die Addition sich voneinander nicht nur unterscheidender, sondern auch abgrenzender, in sich geschlossener Minderheiten und Identitäten. Dann bedarf es grundlegender Gemeinsamkeiten, zu denen selbstverständlich die gemeinsame Sprache gehört, natürlich auch die Anerkennung von Recht und Gesetz und gewiss ebenso der gerühmte und notwendige Verfassungspatriotismus.
Aber ich glaube, das reicht nicht. Darüber hinaus muss es die immer neue Verständigung darüber geben, was uns als Verschiedene miteinander verbindet und verbindlich ist in den Vorstellungen von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde, Toleranz usw., also in den unsere liberale, offene Gesellschaft tragenden Werten und in den geschichtlich geprägten kulturellen Normen, Erinnerungen, Traditionen. Solcherart definierte kulturelle Identität ist das Gegenteil von dem, worauf Identitätspolitik von rechts oder gelegentlich auch von links zielt.
NG FH: Schauen wir zunächst nach rechts. Völkische und Rechtsextreme bezeichnen sich heute als identitäre Bewegung, die dahinterstehende Theorie des Ethnopluralismus widerspricht doch der pluralistischen Demokratie?
Thierse: Das Gefährliche und Illusionäre rechter Identitätspolitik besteht darin, dass sie kulturelle nationale Identität als ethnische und kulturelle Homogenität missversteht und als solche durchsetzen will, also nicht Unterscheidung, sondern Ab- und Ausgrenzung betreibt bis zur Intoleranz und zum Hass gegenüber den Anderen, den Fremden. Das ist illusionär und das ist auch unproduktiv in einer offenen, entgrenzten Welt des materiellen und ideellen Austausches. Das ist gefährlich, weil es zu Gewalt führt. Rechte Identitätspolitik benutzt, das ist ja unübersehbar, soziale Abstiegs- und Verlustängste, ökonomische Zukunftsunsicherheiten, kulturelle Entheimatungsbefürchtungen, nicht nur von Modernisierungsverlierern, mobilisiert Vorurteile und übersetzt diese in politische Aggressivität, wie das Beispiel der USA drastisch gezeigt hat und in Deutschland das Beispiel der AfD.
Die angemessene Antwort darauf kann nicht im einfachen Bestreiten oder Zurückweisen der Ängste und Unsicherheiten bestehen. Das erweist sich als gefährliche Ignoranz und Arroganz und gerade Sozialdemokraten sollen und dürfen diesen Eindruck nicht erwecken. Das aber ist auch genau die Gefahr einer linken Identitätspolitik: die Abwehr, die Ablehnung von Ängsten und Unsicherheiten.
NG FH: Noch einmal nachgefragt, Rechtspopulisten beschwören die nationale Identität: Ist sie wirklich notwendig etwas Falsches und Gefährliches, trotz Europa ist sie ja nicht weg, spätestens bei der nächsten Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft erleiden wir sie doch?
Thierse: Zunächst einmal meine ich, Heimat und Patriotismus, Nationalkultur und Kulturnation, das sind Begriffe und Realitäten, die wir nicht den Rechten überlassen dürfen. Sie sind nicht reaktionäre Residuen einer Vergangenheit, die gerade vergeht. Schauen wir ringsum. Der Blick in die europäische Nachbarschaft und auf den Globus zeigt, die Nation ist keine erledigte historische Größe. Übrigens die Pandemie hat gerade wieder erwiesen, wie notwendig diese Solidargemeinschaft, nämlich der nationale Sozialstaat, ist. Gerade in Zeiten dramatischer Veränderungen, von Entgrenzungen und Beschleunigungen, die wir im Begriff Globalisierung zusammenfassen, in Zeiten technischer Revolutionen und der Bewältigung der ökologischen Katastrophe und eines neuen Schubs von Migrationen und Pluralisierungen, gerade in solchen – also in den gegenwärtigen – Zeiten ist das Bedürfnis nach sozialer und kultureller Beheimatung groß. Eine Antwort auf dieses Bedürfnis ist die Nation. Das nicht wahrhaben zu wollen, halte ich für elitäre, arrogante Dummheit. Allerdings, die Veränderungen, die wir erleben, machen die Fiktion einer homogenen Nationalkultur in der Tradition von Johann Gottfried Herder endgültig obsolet.
Aber trotzdem ist Kultur auch nicht nur Interkultur oder kulturelles McWorld oder Kulturplasma, um nur ein paar der Modebegriffe aufzuzählen. Kultur ist und bleibt ein immer auch regional und national bestimmtes, geschichtlich geprägtes Ensemble, ein Ensemble von Lebensstilen und Lebenspraktiken, von Überlieferungen und Erinnerungen, von Einstellungen und Überzeugungen, von ästhetischen Formen und künstlerischem Gestalten. Und genau als solches Ensemble prägt die Kultur die relative stabile Identität einer Gruppe, einer Gesellschaft und eben auch einer Nation. Und ich füge sofort hinzu: und ändert sich dabei! Denn Kultur ist selbst auch der eigentliche Raum der Bildung und Veränderung von Identitäten, der Vergewisserung des Eigenen und der Aneignung, des Erlernens von Fremdem. Das macht Kultur so wichtig und Nation eben nicht überflüssig.
NG FH: Rechte Identitätspolitik, die einen solch offenen Kulturbegriff bekämpft, ist klar antidemokratisch. Derzeit besonders in der Diskussion ist Identitätspolitik von links: Wo ist diese emanzipatorisch und verteidigt Minderheiten und wo wird sie problematisch?
Thierse: Zunächst und vor allem, die emanzipatorische Absicht, das berechtigte Interesse für (bisherige) Minderheiten gleiche soziale, ökonomische und politische Rechte zu erringen, die verständliche Ungeduld und Leidenschaft dabei, das alles verdient Respekt und tätige politische Unterstützung. Ich sage es noch einmal pointiert: Die Gleichheitsfrage so entschieden zu stellen, das ist links, das ist sozialdemokratisch. Es ist eine Antwort auf erfahrene Benachteiligungen und auf Spaltungen. In ihrer Entschiedenheit aber, das gilt es zu bedenken, ist linke Identitätspolitik zum Teil in der Gefahr, nicht wahrhaben zu wollen und akzeptieren zu können, dass nicht nur Minderheiten sondern auch Mehrheiten berechtigte kulturelle Ansprüche haben und dass diese nicht als bloß konservativ oder reaktionär oder gar als rassistisch denunziert werden sollten.
Linke Identitätspolitik ist in der Gefahr die unausweichlichen Verständigungs- und Klärungsprozesse, in gewiss erklärlicher Ungeduld, teilweise zu verkürzen und zu verengen. Aber es wird nicht ohne die Mühsal von Dialogen und Diskussionen gehen. Diese zu verweigern, das ist genau das, was unter dem Schlagwort Cancel Culture aus den USA kommend sich zu verbreiten beginnt. Menschen, die andere, abweichende Ansichten haben und die eine andere als die verordnete Sprache benutzen, aus dem offenen Diskurs in den Medien oder aus der Universität auszuschließen, das kann ich nicht für links und nicht für demokratische politische Kultur halten. Das ist eben das, was das Schimpfwort Cancel Culture meint.
Aber damit das klar ist: Alle zu Wort kommen zu lassen, heißt ja nicht alles widerspruchslos hinzunehmen. Streit, Debatte und nicht Verbote sind Kennzeichen demokratischer Kultur. Übrigens seit Immanuel Kant, dem nun auch des Rassismus und Kolonialismus Verdächtigten, und der Aufklärung gilt: Es sind Vernunftgründe, die entscheiden sollen und nicht Herkunft und soziale Stellung.
Die eigene Betroffenheit, das subjektive Erleben und das individuelle Wahrnehmen sollen und dürfen nicht das begründende Argument ersetzen. Biografische Prägungen – und seien sie noch so bitter – dürfen nicht als Vorwand dafür dienen, unsympathische gegenteilige Ansichten zu diskreditieren und aus dem Diskurs auszuschließen. Opfer sind unbedingt zu hören, aber sie haben nicht per se recht und sollten auch nicht selbst Recht sprechen und den Diskurs entscheiden.
NG FH: Da würde ich gerne konkreter nach ein paar Beispielen fragen, wo die Grenzen verlaufen zwischen dem, was berechtigte aufklärerische Absicht ist, und der zur Cancel Culture führenden falschen Radikalisierung und Feindbildproduktion.
Thierse: Es gilt immer die Balance zu halten. Übereifer, falsche Radikalisierungen, verfehlte Feindbilder schaden dem Kampf um eine Gesellschaft, in der wir Menschen als Verschiedene und doch Gleiche ohne Angst leben können, um mein Ideal in eine altbekannte Formulierung zu kleiden. Ich nenne einige Beispiele, wo diese Balance danebengegangen ist.
Mein erstes Beispiel sind die Forderungen nach umfassenden Quotierungen. Natürlich ist die Forderung einer Frauenquote notwendig und berechtigt. Natürlich ist auch die Forderung nach einer Quote für Migranten hoch verständlich. Und ebenso die und erst recht die Forderung nach einer Quote für Menschen mit Behinderungen. Aber wie weit wollen wir gehen? Wenn jede Gruppe sich darauf konzentriert, vor allem sich selbst zu repräsentieren, wenn Herkunfts- und Geschlechts- und Religionsidentitäten dominant werden, dann wird es schwierig für demokratische Gesellschaften. Insofern scheint mir Quotierung nicht die allein selig machende Antwort auf das tatsächliche Problem der Repräsentation in einer offenen demokratischen, diversifizierten Gesellschaft.
NG FH: In den geschichtspolitischen und kulturhistorischen Debatten stehen derzeit Fragen des Postkolonialismus, wieweit der frühere Zeitgeist des Rassismus bis heute sein Unwesen treibt, ganz vorne.
Thierse:Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten ist der programmatische Titel eines Buches von Alice Hasters. Ja, wir Weiße haben zuzuhören, haben Diskriminierungen wahrzunehmen und zu überwinden. Aber die entschiedene Kritik an der Ideologie der weißen Überlegenheit darf nicht zu einem Mythos, nicht zum Mythos der Erbschuld des weißen Mannes werden. Die Rede vom strukturell ubiquitären Rassismus in unserer Gesellschaft verleiht diesem etwas, wie ich empfinde, Unentrinnbares, nach dem Motto: Wer weiß ist, ist schon schuldig, das Opfer habe immer schon moralisch Recht, Blackfacing sei zu verbieten, kulturelle Aneignung über Hautfarben und Ethniengrenzen hinweg sei nicht erlaubt. Verbote und Gebote von sprachlichen Bezeichnungen folgen. All das, so erklärlich es sein mag, erzeugt falsche kulturelle Frontbildungen, Unsicherheiten und Abwehr. Eine Abwehr, die offensichtlich nicht nur am rechten Rand, sondern bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Umso mehr bestätigt diese dann wieder den Rassismusvorwurf, ein Circulus vitiosus. Aber was ist dadurch gewonnen, durch den ubiquitären Rassismusvorwurf?
Ein drittes Beispiel: An diese Frage schließt sich die Forderung nach Streichung des Begriffs Rasse aus dem Grundgesetz an. Diese Forderung ist gewiss nachvollziehbar, denn anthropologisch-naturwissenschaftlich gesehen gibt es Rassen gar nicht. Es gibt sie nur als gesellschaftliches Vorurteilskonstrukt mit bösesten Folgen, wie gerade wir Deutschen wissen müssen. Die Erfahrung des Nazirassismus aber war ja gerade das Motiv der Mütter und Väter des Grundgesetzes, nämlich der Wirkmächtigkeit dieses Konstruktes zu begegnen und das in die Verfassung hineinzuschreiben. Die Streichung des Wortes Rasse, das muss man ganz nüchtern wissen, entlastet uns nicht vom Kampf gegen den Rassismus, der auch ohne das Wort Rasse – fürchte ich – weiterleben wird. Deshalb wird vermutlich, vielleicht ist das die Lösung, das kleine Wörtchen rassistisch an die Stelle des bisherigen Begriffs Rasse treten.
NG FH: Den Schriftsetzer, Germanisten und Kulturwissenschaftler Thierse muss man an dieser Stelle natürlich auch nach der aktuellen sprachpolitischen Auseinandersetzung fragen. Auch unsere Redaktion steht in der feministischen Kritik, wenn Autoren am generischen Maskulinum festhalten wollen und sich, etwa aus ästhetischen Gründen, der sogenannten gendergerechten Sprache mit ihren Unterstrichen, Sternchen, Slashs usw. verweigern.
Thierse: Das ist gewiss ein weiteres Beispiel: Die Forderung nicht nur nach gendersensibler, sondern überhaupt nach minderheitensensibler Sprache – so berechtigt sie ist – erleichtert gemeinschaftsbildende Kommunikation nicht in jedem Fall, so meine Beobachtung. Wenn Hochschullehrer sich zaghaft und unsicher erkundigen müssen, wie ihre Studierenden angeredet werden möchten, ob mit »Frau« oder »Herr« oder »Mensch«, mit »er« oder »sie« oder »es«, dann ist das keine Harmlosigkeit mehr. Und diejenigen, die das für eine Übertreibung halten, sind nicht einfach reaktionär, so wenig wie die es sind, die sich gegen Reglementierungen von Sprache per Anordnung oder Sprachverbote wenden. Ich wünsche mir einfach mehr Vertrauen in die Entwicklung von Sprache, die sich, wie wir aus ihrer Geschichte wissen, ja ständig wandelt.
Ein fünftes Beispiel: Unübersehbar gehört zur gegenwärtigen Konfliktlage eine neue Bilderstürmerei, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns im Land. Wir wissen aus der Geschichte, dass Zeiten der Bilderstürmerei nie nur gute Zeiten waren. Die Tilgung von Namen, Denkmalstürze, Denunziation von Geistesgrößen aus der Geschichte gehörten meistens zu revolutionären blutigen Umstürzen. Man hat den Eindruck, hier gehe es in der Gegenwart um symbolische Befreiungsakte von lastender, lästiger, böser Geschichte. Die subjektive Betroffenheit zählt mehr als der genaue, differenzierte Blick auf die Bedeutungsgeschichte eines Namens, eines Denkmals, einer Person, wie die Beispiele Mohrenstraße und Onkel Toms Hütte in Berlin zeigen. Weil mich der Name beleidigt und verletzt, muss er weg, das ist die fatale Handlungsmaxime.
Nun sollen und dürfen wahrlich nicht alle Namen und Denkmäler sakrosankt sein. Aber man sollte doch wissen, die Schleifungen von Namen und Denkmälern sind Ersatzhandlungen. Denn nicht die Hinterlassenschaften, sondern die Menschen von heute sind die Akteure von Rassismus. Leider tritt allzu oft an die Stelle von Historisierung die Bewertung nach heutigen Maßstäben aus der Position moralischer Gewissheiten. In jedem einzelnen Fall, meine ich allerdings dagegen, ist breite öffentliche Diskussion sinnvoller und als Konsequenz ist Kommentierung statt Zerstörung der bessere Weg. Eine widerspruchsvolle gegenständliche Geschichtslandschaft jedenfalls ist eine bessere Grundlage für gemeinsames historisches Lernen. Wir brauchen die Stolpersteine der Geschichte.
Und, um es weiter zu treiben, von welchen Größen der Geschichte wollen wir unsere Städte und unsere Gedächtnisse denn noch alles befreien lassen? Von Martin Luther? Karl Marx? Richard Wagner, diesem Antisemiten? Von Immanuel Kant und Otto Bismarck, diesen Kolonialisten? Nein, die Reinigung und Liquidation von Geschichte war bisher die Sache von Diktatoren, autoritären Regimen, religiös-weltanschaulichen Fanatikern, das darf nicht Sache von Demokratien werden.
NG FH: Der Bremer Politologe Philip Manow formulierte den Satz: »Muss es nicht nachdenklich stimmen, wenn die Klasse mit dem maximalen kulturellen Kapital diagnostiziert, populistischer Protest sei in erster Linie Ausdruck eines Mangels an kulturellem Kapitel?« Wäre es nicht gerade Aufgabe der SPD, identitätspolitische Brücken zu bauen? Sich eben nicht auf die akademische Mittelklasse, auf das kulturelle Emanzipationsstreben zu fixieren, sondern gerade die Interessen der sich ökonomisch und kulturell bedroht sehenden unteren Schichten und prekären Lebenslagen aufzugreifen?
Thierse: Die Beobachtung trifft zu und ist nicht neu. Soziale Gegensätze und Klassenspaltungen sind immer auch kulturelle Spaltungen. Insofern ist die Arbeit für kulturelle Gerechtigkeit, also für gleichberechtigte Chancen zur Teilhabe an Kultur, eine wesentliche Dimension von Gerechtigkeitspolitik insgesamt.
Das sollten gerade Sozialdemokraten wissen. Insofern aber hat Identitätspolitik in diesem Sinne ihre gewichtige Berechtigung, als Kampf um gerechte Teilhabechancen und Teilhaberechte. Für die Sozialdemokratie nun geht es darum, aus der eigenen Erfahrung, wie der in den europäischen Nachbarländern und den USA zu lernen. Die Zustimmung bei kulturellen und ökonomischen Eliten darf nicht bezahlt werden mit dem Verlust an Zustimmung in der Arbeiterschaft. Die Sozialdemokratie darf nicht in die Falle der Alternative tappen zwischen den vorrangigen Anerkennungs- und Repräsentationsbedürfnissen von verschiedensten Minderheiten einerseits und andererseits dem Ernstnehmen von sozialen Abstiegsängsten, ökonomischen Zukunftsunsicherheiten und kulturellen Entheimatungsbefürchtungen im Zentrum der Gesellschaft, bei sozialen Mehrheiten, bei Modernisierungsbedrohten beziehungsweise -verlierern.
Das Angebot der Sozialdemokratie muss eines für beide Seiten sein. Ein Angebot, das die Durchsetzung von sozialer, rechtlicher, politischer Gleichheit verbindet mit der Anerkennungspraxis von ethnischer, religiös-weltanschaulicher und kultureller Verschiedenheit und Vielfalt. Ein Angebot allerdings, das die gemeinsamen Interessen definiert, aufsucht, bündelt und auf die eigentlichen Zukunftsaufgaben lenkt, nämlich die Bewältigung der großen Herausforderungen von Globalisierung, ökologischem Umbau, digitaler Transformation, demokratischem Wandel usw. Das, meine ich, könnte und sollte mehrheitsfähig sein.
NG FH: Kann man zusammenfassend sagen, so wichtig Gleichstellungspolitik von Frauen, Schwulen, Behinderten, religiösen Gemeinschaften, Zugewanderten, Farbigen usw. ist, wird es nicht reichen, sich nur für diese gesellschaftlichen Gruppen und die kulturelle Vielfalt stark zu machen, vielmehr sollten wir auch nach gesamtgesellschaftlicher Solidarität, nach einem neuen Wir suchen?
Thierse: Wir leben gewiss und mehr denn je in einer ethnisch, kulturell, religiös-weltanschaulich pluralen Gesellschaft. In ihr ist Diversität nicht das Ziel, sondern eine faktische Voraussetzung unserer Demokratie und Kultur. Das Ziel muss vielmehr sein, diese Diversität friedlich und produktiv leben zu können. Dieses Ziel zu erreichen, verlangt nicht nur den energischen Einsatz für die Anerkennung und Verwirklichung der jeweils eigenen Identität, der eigenen individuellen und Gruppeninteressen. Sondern das verlangt in eigentlich noch größerem Ausmaß die Bereitschaft und Fähigkeit, das Eigene in Bezug auf das Gemeinsame, auf das Gemeinwohl zu denken und zu praktizieren, also auch manchmal das Eigene zu relativieren.
Der unabdingbare Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist eben nicht alles. Er muss vielmehr eingebettet sein in Gemeinsinn, in die Anerkennung von Regeln und Verbindlichkeiten, übrigens auch in die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen. Sonst ist der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet. Oder wird gar zerstört, wie wir das durchaus schon erleben, durch radikale Meinungsbiotope, tiefe Wahrnehmungsspaltungen und eben auch konkurrierende Identitätsgruppenansprüche in der durch verschiedene Echokammern aufgesplitterten digitalen (man muss schon fast sagen: sogenannten) Öffentlichkeit. Weil der gesellschaftliche Zusammenhalt in einer diversen sozial und kulturell fragmentierten »Gesellschaft der Singularitäten« – wie der schöne Begriff von Andreas Reckwitz heißt – nicht mehr selbstverständlich ist, muss er ausdrücklich das Ziel von Politik und von kulturellen Anstrengungen sein, eben vor allem der Sozialdemokratie. Es muss ihr kulturelles Angebot sein, dass Solidarität, um die geht es nämlich, kein einseitiges Verhältnis ist, kein Anspruchsverhältnis gegen die anderen, sondern auf Wechselseitigkeit und das Ganze umfassend zielt.

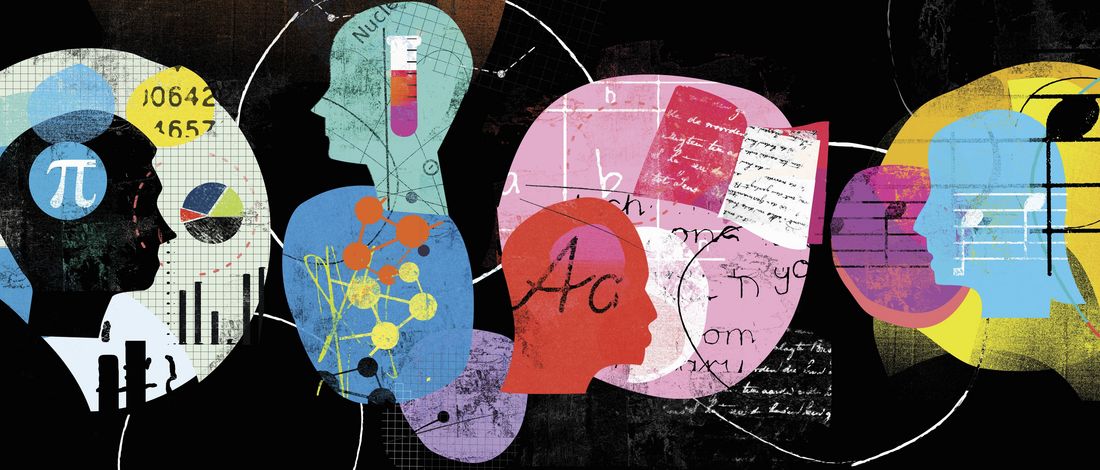


Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!